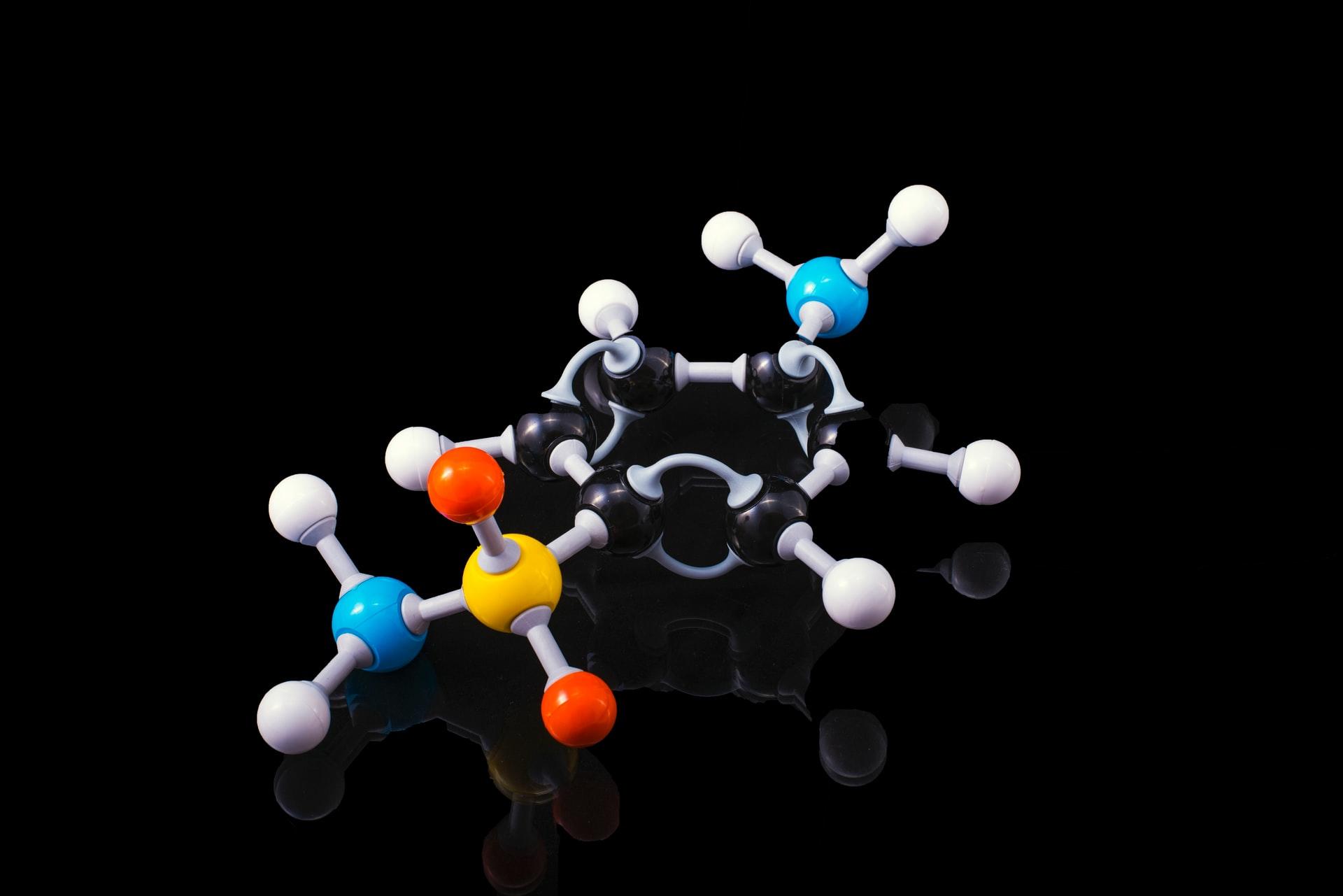Als der schwedische Chemiker Alfred Nobel 1896 kinderlos starb, hinterließ er ein beachtliches Vermögen. In seinem Testament hatte er festgehalten, dass dies einer Stiftung in seinem Namen zu, die die Zinsen als Preisgeld an Wissenschaftler*innen ausgezahlt werden sollen, „die im vergangenen Jahr der Menschheit den größten Nutzen erbracht haben“.
Nobel verfügte, dass der Preis jährlich in fünf verschiedenen Bereichen werden soll: Literatur, Frieden, Physiologie oder Medizin, Physik und natürlich auch Chemie. Am 10. Dezember 1901, Nobels fünftem Todestag, fand die erste Preisverleihung statt.
Der erste Chemie-Nobelpreis ging an den niederländischen Chemiker Jacobus Henricus van ’t Hoff, der die Gesetze der chemischen Dynamik und des osmotischen Drucks in Lösungen entschlüsselt hatte. Seither gab es allein im Wissenschaftsbereich der Chemie in 187 Preisträger*innen (Stand: Dezember 2021). Die hohe Zahl kommt dadurch zu Stande, dass sich bei fast der Hälfte der Verleihungen zwei bis drei Personen den Preis geteilt haben.
Wir wollen dir hier eine Auswahl an bisherigen Chemie-Nobelpreisträger*innen sowie ihre Entdeckungen und Entwicklungen näher vorstellen.

Alle Chemie Nobelpreisträger Liste
Zum Abschluss wollen wir dir noch einige weitere Namen von Preisträgern des Nobelpreises für Chemie mitgeben. Wie von Alfred Nobel verfügt, befinden sich darunter nur Wissenschaftler*innen, die mit ihrer Arbeit der Menschheit einen großen Dienst erwiesen haben. Auffällig ist jedoch, dass sich kein einziger Schwarzer Chemiker darunter befindet.
Gewinner Nobelpreis für Chemie 1900 bis 1909
| Jahr | Person | Land | Begründung für die Preisvergabe |
|---|---|---|---|
| 1901 | Jacobus Henricus van ’t Hoff (1852–1911) | Niederlande | „als Anerkennung des außerordentlichen Verdienstes, den er sich durch die Entdeckung der Gesetze der chemischen Dynamik und des osmotischen Druckes in Lösungen erworben hat“ |
| 1902 | Emil Fischer (1852–1919) | Deutsches Reich | „als Anerkennung des außerordentlichen Verdienstes, den er sich durch seine synthetischen Arbeiten auf dem Gebiet der Zucker- und Puringruppen erworben hat“ |
| 1903 | Svante Arrhenius (1859–1927) | Schweden | „als Anerkennung des außerordentlichen Verdienstes, den er sich durch seine Theorie über die elektrolytische Dissoziation um die Entwicklung der Chemie erworben hat“ |
| 1904 | Sir William Ramsay (1852–1916) | Vereinigtes Königreich | „als Anerkennung des Verdienstes, den er sich durch die Entdeckung der indifferenten gasförmigen Grundstoffe Edelgase in der Luft und die Bestimmung ihres Platzes im periodischen System erworben hat“ |
| 1905 | Adolf von Baeyer (1835–1917) | Deutsches Reich | „als Anerkennung des Verdienstes, den er sich um die Entwicklung der organischen Chemie und der chemischen Industrie durch seine Arbeiten über die organischen Farbstoffe und die hydroaromatischen Verbindungen erworben hat“ |
| 1906 | Henri Moissan (1852–1907) | Frankreich | „als Anerkennung des großen Verdienstes, den er sich durch seine Untersuchung und Isolierung des Elements Fluor sowie durch die Einführung des nach ihm benannten elektrischen Ofens in den Dienst der Wissenschaft erworben hat“ |
| 1907 | Eduard Buchner (1860–1917) | Deutsches Reich | „für seine biochemischen Untersuchungen und die Entdeckung der zellfreien Gärung“ |
| 1908 | Ernest Rutherford (1871–1937) | Vereinigtes Königreich (geb. in Nelson, Neuseeland) | „für seine Untersuchungen über den Zerfall der Elemente und die Chemie der radioaktiven Stoffe“ |
| 1909 | Wilhelm Ostwald (1853–1932) | Deutsches Reich (geb. in Riga, damals Russisches Kaiserreich) | „als Anerkennung für seine Arbeiten über die Katalyse sowie für seine grundlegenden Untersuchungen über chemische Gleichgewichtsverhältnisse und Reaktionsgeschwindigkeiten“ |
Gewinner Nobelpreis für Chemie 1910 bis 1919
| Jahr | Person | Land | Begründung für die Preisvergabe |
|---|---|---|---|
| 1910 | Otto Wallach (1847–1931) | Deutsches Reich | „als Anerkennung des Verdienstes, den er sich um die Entwicklung der organischen Chemie und der chemischen Industrie durch seine bahnbrechenden Arbeiten auf dem Gebiet der alicyclischen Verbindungen erworben hat“ |
| 1911 | Marie Curie (1867–1934) | Frankreich (geb. in Warschau, Kongresspolen) | „als Anerkennung des Verdienstes, das sie sich um die Entwicklung der Chemie erworben hat durch die Entdeckung der Elemente Radium und Polonium, durch die Charakterisierung des Radiums und dessen Isolierung in metallischem Zustand und durch ihre Untersuchungen über die Natur und die chemischen Verbindungen dieses wichtigen Elements“ |
| 1912 | Victor Grignard (1871–1935) | Frankreich | „für das von ihm aufgefundene sog. Grignard’sche Reagenz, das in den letzten Jahren in hohem Grad den Fortschritt der organischen Chemie gefördert hat“ |
| Paul Sabatier (1854–1941) | Frankreich | „für seine Methode, organische Verbindungen bei Gegenwart fein verteilter Metalle zu hydrieren, wodurch der Fortschritt der organischen Chemie in den letzten Jahren in hohem Grad gefördert worden ist“ | |
| 1913 | Alfred Werner (1866–1919) | Schweiz (geb. in Mülhausen, damals Französisches Kaiserreich) | „auf Grund seiner Arbeiten über die Bindungsverhältnisse der Atome im Molekül, wodurch er ältere Forschungsgebiete geklärt und neue erschlossen hat, besonders im Bereich der anorganischen Chemie“ |
| 1914 | Theodore William Richards (1868–1928) | Vereinigte Staaten | „als Anerkennung seiner genauen Bestimmungen des Atomgewichts von zahlreichen chemischen Elementen“ |
| 1915 | Richard Willstätter (1872–1942) | Deutsches Reich | „für seine Untersuchungen der Farbstoffe im Pflanzenreich, vor allem des Chlorophylls“ |
| 1916 | nicht verliehen | ||
| 1917 | nicht verliehen | ||
| 1918 | Fritz Haber (1868–1934) | Deutsches Reich | „für die Synthese von Ammoniak aus dessen Elementen“ (Haber-Bosch-Verfahren) |
| 1919 | nicht verliehen |
Gewinner Nobelpreis für Chemie 1920 bis 1929
| Jahr | Person | Land | Begründung für die Preisvergabe |
|---|---|---|---|
| 1920 | Walther Nernst (1864–1941) | Deutsches Reich | „als Anerkennung für seine thermochemischen Arbeiten“ |
| 1921 | Frederick Soddy (1877–1956) | Vereinigtes Königreich | „für seine Beiträge zur Kenntnis der Chemie der radioaktiven Stoffe und seine Untersuchungen über das Vorkommen und die Natur der Isotopen“ |
| 1922 | Francis William Aston (1877–1945) | Vereinigtes Königreich | „für seine Entdeckung einer großen Zahl von Isotopen in mehreren nicht radioaktiven Elementen mit Hilfe seines Massenspektrographen sowie für seine Entdeckung des so genannten Gesetzes der Ganzzahligkeit“ |
| 1923 | Fritz Pregl (1869–1930) | Österreich | „für die von ihm entwickelte Mikroanalyse organischer Substanzen“ |
| 1924 | nicht verliehen | ||
| 1925 | Richard Zsigmondy (1865–1929) | Deutsches Reich (geb. in Wien, Österreich) | „für die Aufklärung der heterogenen Natur kolloidaler Lösungen sowie für die dabei angewandten Methoden, die grundlegend für die moderne Kolloidchemie sind“ |
| 1926 | The Svedberg (1884–1971) | Schweden | „für seine Arbeiten über disperse Systeme“ |
| 1927 | Heinrich Wieland (1877–1957) | Deutsches Reich | „für seine Forschungen über die Zusammensetzung der Gallensäure und verwandter Substanzen“ |
| 1928 | Adolf Windaus (1876–1959) | Deutsches Reich | „für seine Verdienste um die Erforschung des Aufbaus der Sterine und ihres Zusammenhanges mit den Vitaminen“ |
| 1929 | Arthur Harden (1865–1940) | Vereinigtes Königreich | „für ihre Forschung über die Zuckervergärung und deren Anteil der Enzyme an diesem Vorgang“ |
| Hans von Euler-Chelpin (1873–1964) | Schweden (geb. in Augsburg, Deutsches Reich) |
Gewinner Nobelpreis für Chemie 1930 bis 1939
| Jahr | Person | Land | Begründung für die Preisvergabe |
|---|---|---|---|
| 1930 | Hans Fischer (1881–1945) | Deutsches Reich | „für seine Arbeiten über den strukturellen Aufbau der Blut- und Pflanzenfarbstoffe und für die Synthese des Hämins“ |
| 1931 | Carl Bosch (1874–1940) | Deutsches Reich | „für ihre Verdienste um die Entdeckung und Entwicklung der chemischen Hochdruckverfahren“ |
| Friedrich Bergius (1884–1949) | Deutsches Reich | ||
| 1932 | Irving Langmuir (1881–1957) | Vereinigte Staaten | „für seine Entdeckungen und Forschungen im Bereich der Oberflächenchemie“ |
| 1933 | nicht verliehen | ||
| 1934 | Harold C. Urey (1893–1981) | Vereinigte Staaten | „für seine Entdeckung des schweren Wasserstoffes“ |
| 1935 | Frédéric Joliot-Curie (1900–1958) | Frankreich | „für ihre gemeinsam durchgeführten Darstellungen von neuen radioaktiven Elementen“ |
| Irène Joliot-Curie (1897–1956) | Frankreich | ||
| 1936 | Peter Debye (1884–1966) | Niederlande | „für seine Beiträge zu unserer Kenntnis der Molekularstrukturen durch seine Forschungen über Dipolmomente, über die Beugung von Röntgenstrahlen und an Elektronen in Gasen“ |
| 1937 | Walter Norman Haworth (1883–1950) | Vereinigtes Königreich | „für seine Forschungen über Kohlenhydrate und Vitamin C“ |
| Paul Karrer (1889–1971) | Schweiz | „für seine Forschungen über die Carotinoide und Flavine sowie über die Vitamine A und B2“ | |
| 1938 | Richard Kuhn (1900–1967) | Deutsches Reich (geb. in Wien, Kaisertum Österreich) | „für seine Arbeiten über Carotinoide und Vitamine“ |
| 1939 | Adolf Butenandt (1903–1995) | Deutsches Reich | „für seine Arbeiten über Sexualhormone“ |
| Leopold Ružička (1887–1976) | Schweiz (geb. in Vukovar, damals Kaisertum Österreich) | „für seine Arbeiten an Polymethylenen und höheren Terpenen“ |
Gewinner Nobelpreis für Chemie 1940 bis 1949
| Jahr | Person | Land | Begründung für die Preisvergabe |
|---|---|---|---|
| 1940 | nicht verliehen | ||
| 1941 | nicht verliehen | ||
| 1942 | nicht verliehen | ||
| 1943 | George de Hevesy (1885–1966) | Ungarn | „für seine Arbeiten über die Anwendung der Isotope als Indikatoren bei der Erforschung chemischer Prozesse“ |
| 1944 | Otto Hahn (1879–1968) | Deutsches Reich | „für seine Entdeckung der Kernspaltung von Atomen“ |
| 1945 | Artturi Ilmari Virtanen (1895–1973) | Finnland | „für seine Untersuchungen und Entdeckungen auf dem Gebiet der Agrikultur- und Nahrungsmittelchemie, insbesondere für seine Methode der Konservierung von Futtermitteln und Futterpflanzen“ |
| 1946 | James Batcheller Sumner (1887–1955) | Vereinigte Staaten | „für seine Entdeckung der Kristallisierbarkeit von Enzymen“ |
| John Howard Northrop (1891–1987) | Vereinigte Staaten | ||
| Wendell Meredith Stanley (1904–1971) | Vereinigte Staaten | ||
| 1947 | Robert Robinson (1886–1975) | Vereinigtes Königreich | „für seine Untersuchungen über biologisch wichtige Pflanzenprodukte insbesondere Alkaloide“ |
| 1948 | Arne Tiselius (1902–1971) | Schweden | „für seine Arbeiten über die Analyse mit Hilfe von Elektrophorese und Adsorption, insbesondere für seine Entdeckungen über die komplexe Natur von Serum-Proteinen“ |
| 1949 | William Francis Giauque (1895–1982) | Vereinigte Staaten | „für seinen Beitrag zur chemischen Thermodynamik, insbesondere für seine Untersuchungen über die Eigenschaften bei extrem tiefen Temperaturen“ |
Gewinner Nobelpreis für Chemie 1950 bis 1959
| Jahr | Person | Land | Begründung für die Preisvergabe |
|---|---|---|---|
| 1950 | Otto Diels (1876–1954) | BR Deutschland | „für ihre Entdeckungen und die Entwicklung der Dien-Synthese“ |
| Kurt Alder (1902–1958) | BR Deutschland | ||
| 1951 | Edwin Mattison McMillan (1907–1991) | Vereinigte Staaten | „für ihre Entdeckungen in der Chemie der Transurane“ |
| Glenn T. Seaborg (1912–1999) | Vereinigte Staaten | ||
| 1952 | Archer J. P. Martin (1910–2002) | Vereinigtes Königreich | „für ihre Erfindung der Verteilungs-Chromatographie“ |
| Richard L. M. Synge (1914–1994) | Vereinigtes Königreich | ||
| 1953 | Hermann Staudinger (1881–1965) | BR Deutschland | „für seine Entdeckungen auf dem Gebiet der makromolekularen Chemie“ |
| 1954 | Linus Pauling (1901–1994) | Vereinigte Staaten | „für seine Forschungen über die Natur der chemischen Bindung und ihre Anwendung zur Aufhellung der Struktur komplexer Substanzen“ |
| 1955 | Vincent du Vigneaud (1901–1978) | Vereinigte Staaten | „für seine Arbeiten der biochemisch bedeutsamen Schwefelverbindungen, besonders für die erste Synthese eines Polypeptidhormons“ |
| 1956 | Cyril Norman Hinshelwood (1897–1967) | Vereinigtes Königreich | „für ihre Forschungen über die Mechanismen chemischer Reaktionen“ |
| Nikolai Nikolajewitsch Semjonow (1896–1986) | Sowjetunion | ||
| 1957 | Alexander Robertus Todd (1907–1997) | Vereinigtes Königreich | „für seine Arbeiten über Nukleotide und Co-Enzymnukleotide“ |
| 1958 | Frederick Sanger (1918–2013) | Vereinigtes Königreich | „für seine Arbeiten über die Struktur der Proteine, besonders des Insulins“ |
| 1959 | Jaroslav Heyrovský (1890–1967) | Tschechoslowakei | „für seine Entdeckung und Entwicklung der polarographischen Methode der Analyse“ |
Gewinner Nobelpreis für Chemie 1960 bis 1969
| Jahr | Person | Land | Begründung für die Preisvergabe |
|---|---|---|---|
| 1960 | Willard Libby (1908–1980) | Vereinigte Staaten | „für seine Methode der Anwendung von Kohlenstoff 14 zur Altersbestimmung in Archäologie, Geologie, Geophysik und anderen Zweigen der Wissenschaft“ (siehe: Radiokarbonmethode) |
| 1961 | Melvin Calvin (1911–1997) | Vereinigte Staaten | „für seine Forschungen über die Kohlensäure-Assimilation der Pflanzen“ |
| 1962 | Max Ferdinand Perutz (1914–2002) | Vereinigtes Königreich (geb. in Wien, Österreich) | „für ihre Studien über Strukturen der Globulinproteine“ |
| John Cowdery Kendrew (1917–1997) | Vereinigtes Königreich | ||
| 1963 | Karl Ziegler (1898–1973) | BR Deutschland | „für ihre Entdeckungen auf dem Gebiet der Chemie und der Technologie der Hochpolymeren“ (Ziegler-Natta-Verfahren) |
| Giulio Natta (1903–1979) | Italien | ||
| 1964 | Dorothy Crowfoot Hodgkin (1910–1994) | Vereinigtes Königreich | „für ihre Strukturbestimmung biologisch wichtiger Substanzen mit Röntgenstrahlen“ |
| 1965 | Robert B. Woodward (1917–1979) | Vereinigte Staaten | „für seine Arbeiten auf dem Gebiet der Naturstoffsynthesen“ |
| 1966 | Robert Mulliken (1896–1986) | Vereinigte Staaten | „für seine grundlegenden Arbeiten über die chemischen Bindungen und die Elektronenstruktur der Moleküle mit Hilfe der Orbital-Methode“ |
| 1967 | Manfred Eigen (1927–2019) | BR Deutschland | „für ihre Untersuchungen von extrem schnellen chemischen Reaktionen, die durch Zerstörung des Gleichgewichts durch sehr kurze Energieimpulse ausgelöst werden“ |
| Ronald George Wreyford Norrish (1897–1978) | Vereinigtes Königreich | ||
| George Porter (1920–2002) | Vereinigtes Königreich | ||
| 1968 | Lars Onsager (1903–1976) | Vereinigte Staaten (geb. in Oslo, Norwegen) | „für die Entdeckung der nach ihm benannten reziproken Beziehungen, die grundlegend für die Thermodynamik der irreversiblen Prozesse sind“ |
| 1969 | Derek H. R. Barton (1918–1998) | Vereinigtes Königreich | „für ihre Arbeiten in der Entwicklung des Konformationsbegriffes und dessen Anwendung in der Chemie“ |
| Odd Hassel (1897–1981) | Norwegen |
Gewinner Nobelpreis für Chemie 1970 bis 1979
| Jahr | Person | Land | Begründung für die Preisvergabe |
|---|---|---|---|
| 1970 | Luis Federico Leloir (1906–1987) | Argentinien | „für die Entdeckung der Zucker-Nukleotide und ihrer Funktion in der Biosynthese von Kohlenhydraten“ |
| 1971 | Gerhard Herzberg (1904–1999) | Kanada (geb. in Hamburg, Deutsches Reich) | „für seine Arbeiten über die Elektronenstruktur und die Geometrie bei den Molekülen, insbesondere freier Radikale“ |
| 1972 | Christian B. Anfinsen (1916–1995) | Vereinigte Staaten | „für seine Arbeiten über Ribonuklease, insbesondere die Verbindung zwischen Aminosäurereihen und biologisch wirksamen Konformationen“ |
| Stanford Moore (1913–1982) | Vereinigte Staaten | „für ihren Beitrag zum Verständnis der Verbindung zwischen chemischer Struktur und katalytischer Tätigkeit des aktiven Zentrums der Ribonuklease-Moleküle“ | |
| William Howard Stein (1911–1980) | Vereinigte Staaten | ||
| 1973 | Ernst Otto Fischer (1918–2007) | BR Deutschland | „für ihre bahnbrechenden unabhängig voneinander geleisteten Arbeiten über die Chemie der metallorganischen so genannten Sandwich-Verbindungen“ |
| Geoffrey Wilkinson (1921–1996) | Vereinigtes Königreich | ||
| 1974 | Paul Flory (1910–1985) | Vereinigte Staaten | „für seine grundlegenden Leistungen, sowohl theoretisch als auch experimentell, in der physikalischen Chemie der Makromoleküle“ |
| 1975 | John W. Cornforth (1917–2013) | Australien / Vereinigtes Königreich | „für seine Arbeiten über die Stereochemie von Enzym-Katalyse-Reaktionen“ |
| Vladimir Prelog (1906–1998) | Schweiz (geb. in Sarajevo, Österreich-Ungarn) | „für seine Forschungen in der Stereochemie organischer Moleküle und Reaktionen“ | |
| 1976 | William Lipscomb (1919–2011) | Vereinigte Staaten | „für seine Arbeiten über die Struktur der Borane“ |
| 1977 | Ilya Prigogine (1917–2003) | Belgien (geb. in Moskau, Russland) | „für seinen Beitrag zur irreversiblen Thermodynamik, insbesondere zur Theorie der ‚dissipativen Strukturen‘“ |
| 1978 | Peter D. Mitchell (1920–1992) | Vereinigtes Königreich | „für seinen Beitrag zum Verständnis biologischer Energieübertragung durch Entwicklung der chemiosmotischen Theorie“ |
| 1979 | Herbert Charles Brown (1912–2004) | Vereinigte Staaten (geb. in London, Vereinigtes Königreich) | „für ihre Entwicklung von Bor- beziehungsweise Phosphorverbindungen in wichtigen Reagenzien innerhalb organischer Synthesen“ |
| Georg Wittig (1897–1987) | BR Deutschland |
Gewinner Nobelpreis für Chemie 1980 bis 1989
| Jahr | Person | Land | Begründung für die Preisvergabe |
|---|---|---|---|
| 1980 | Paul Berg (1926–2023) | Vereinigte Staaten | „für seine grundlegenden Arbeiten über Nukleinsäuren-Biochemie, unter besonderer Berücksichtigung von Hybrid-DNA“ |
| Walter Gilbert (* 1932) | Vereinigte Staaten | „für ihre Beiträge die Bestimmung von Basensequenzen in Nukleinsäuren betreffend“ | |
| Frederick Sanger (1918–2013) | Vereinigtes Königreich | ||
| 1981 | Fukui Ken’ichi (1918–1998) | Japan | „für ihre unabhängig voneinander entwickelten Theorien über den Verlauf chemischer Reaktionen“ |
| Roald Hoffmann (* 1937) | Vereinigte Staaten (geb. in Złoczów, Polen, heute Ukraine) | ||
| 1982 | Aaron Klug (1926–2018) | Vereinigtes Königreich (geb. in Želva, Litauen) | „für die Entwicklung kristallographischer Verfahren zur Entschlüsselung biologisch wichtiger Nukleinsäure-Protein-Komplexe“ |
| 1983 | Henry Taube (1915–2005) | Vereinigte Staaten (geb. in Saskatoon, Kanada) | „für seine Arbeiten über die Reaktionsmechanismen der Elektronenübertragung, insbesondere bei Metallkomplexen“ |
| 1984 | Robert Bruce Merrifield (1921–2006) | Vereinigte Staaten | „für seine einfache und geniale Methode zur Herstellung von Peptiden und Proteinen“ (Merrifield-Synthese) |
| 1985 | Herbert A. Hauptman (1917–2011) | Vereinigte Staaten | „für ihre hervorragenden Leistungen in der Entwicklung direkter Methoden zur Bestimmung von Kristallstrukturen“ |
| Jerome Karle (1918–2013) | Vereinigte Staaten | ||
| 1986 | Dudley R. Herschbach (* 1932) | Vereinigte Staaten | „für ihre Mitwirkung betreffend der Dynamik chemischer Elementarprozesse“ |
| Yuan T. Lee (* 1936) | Vereinigte Staaten (geb. in Hsinchu, Taiwan) | ||
| John C. Polanyi (* 1929) | Kanada | ||
| 1987 | Donald J. Cram (1919–2001) | Vereinigte Staaten | „für ihre Entwicklung und Verwendung von Molekülen mit strukturspezifischer Wechselwirkung von hoher Selektivität“ (Supramolekulare Chemie) |
| Jean-Marie Lehn (* 1939) | Frankreich | ||
| Charles Pedersen (1904–1989) | Vereinigte Staaten (geb. in Busan, Korea) | ||
| 1988 | Johann Deisenhofer (* 1943) | BR Deutschland | „für die Erforschung des Reaktionszentrums der Photosynthese bei einem Purpurbakterium“ |
| Robert Huber (* 1937) | BR Deutschland | ||
| Hartmut Michel (* 1948) | BR Deutschland | ||
| 1989 | Sidney Altman (1939–2022) | Kanada / Vereinigte Staaten | „für ihre Entdeckung der chemischen Prozesse beschleunigenden Eigenschaften der Ribonukleinsäure“ (Ribozyme) |
| Thomas R. Cech (* 1947) | Vereinigte Staaten |
Gewinner Nobelpreis für Chemie 1990 bis 1999
| Jahr | Person | Land | Begründung für die Preisvergabe |
|---|---|---|---|
| 1990 | Elias James Corey (* 1928) | Vereinigte Staaten | „für seine Formulierung wichtiger Theorien und Entwicklungen von Methoden organischer Synthese“ (Retrosynthese) |
| 1991 | Richard R. Ernst (1933–2021) | Schweiz | „für seine Beiträge zur Entwicklung der hochauflösenden Kernresonanzspektroskopie, einer Methode zur Analyse von Molekülstrukturen“ |
| 1992 | Rudolph Arthur Marcus (* 1923) | Vereinigte Staaten (geb. in Montreal, Kanada) | „für seine wichtigen Beiträge zur Theorie von Elektronentransfer-Reaktionen in chemischen Systemen“ (Marcus-Theorie) |
| 1993 | Kary Mullis (1944–2019) | Vereinigte Staaten | „für seine Entwicklung der Polymerase-Kettenreaktion“ |
| Michael Smith (1932–2000) | Kanada (geb. in Blackpool, Vereinigtes Königreich) | „für seine Entwicklung einer Methode zur Veränderung (Mutagenese) der Desoxyribonukleinsäure, auf der die Erbinformationen gespeichert sind“ | |
| 1994 | George A. Olah (1927–2017) | Vereinigte Staaten (geb. in Budapest, Ungarn) | „für seine Erforschung der Carbokationen“ |
| 1995 | Paul J. Crutzen (1933–2021) | Niederlande | „für ihre Arbeiten zur Chemie der Erdatmosphäre, insbesondere über Bildung und Abbau von Ozon“ |
| Mario J. Molina (1943–2020) | Vereinigte Staaten (geb. in Mexiko-Stadt, Mexiko) | ||
| Frank Sherwood Rowland (1927–2012) | Vereinigte Staaten | ||
| 1996 | Robert F. Curl (1933–2022) | Vereinigte Staaten | „für die Entdeckung der Fullerene, auch Buckyballs genannt, einer neuen Form des Kohlenstoffs mit kugelförmigen Molekülen“ |
| Harold Kroto (1939–2016) | Vereinigtes Königreich | ||
| Richard E. Smalley (1943–2005) | Vereinigte Staaten | ||
| 1997 | Paul Delos Boyer (1918–2018) | Vereinigte Staaten | „für die Klärung der Synthese des energiereichen Moleküls Adenosintriphosphat (ATP)“ |
| John E. Walker (* 1941) | Vereinigtes Königreich | ||
| Jens Christian Skou (1918–2018) | Dänemark | „für die Entdeckung des ionentransportierenden Enzyms Natrium-Kalium-ATPase“ | |
| 1998 | Walter Kohn (1923–2016) | Vereinigte Staaten (geb. in Wien, Österreich) | „für die Entwicklung der Dichtefunktionaltheorie“ |
| John Anthony Pople (1925–2004) | Vereinigtes Königreich | „für die Entwicklung von Methoden, mit denen die Eigenschaften von Molekülen und deren Zusammenwirken in chemischen Prozessen theoretisch erforscht werden können“ | |
| 1999 | Ahmed Zewail (1946–2016) | Ägypten / Vereinigte Staaten | „für seine Studien des Übergangszustands chemischer Reaktionen mit Hilfe der Femtosekundenspektroskopie“ |
Gewinner Nobelpreis für Chemie 2000 bis 2009
| Jahr | Person | Land | Begründung für die Preisvergabe |
|---|---|---|---|
| 2000 | Alan J. Heeger (* 1936) | Vereinigte Staaten | „für die Entdeckung und Entwicklung von leitenden Polymeren“ |
| Alan MacDiarmid (1927–2007) | Vereinigte Staaten / Neuseeland (geb. in Masterton, Neuseeland) | ||
| Hideki Shirakawa (* 1936) | Japan | ||
| 2001 | William S. Knowles (1917–2012) | Vereinigte Staaten | „für ihre Arbeiten über chiral katalysierende Hydrierungsreaktionen“ |
| Ryōji Noyori (* 1938) | Japan | ||
| Barry Sharpless (* 1941) | Vereinigte Staaten | „für seine Arbeiten über chiral katalysierende Oxidationsreaktionen“ (z. B. Sharpless-Epoxidierung) | |
| 2002 | John B. Fenn (1917–2010) | Vereinigte Staaten | „für ihre Entwicklung von weichen Desorptions/Ionisations-Methoden für massenspektrometrische Analysen von biologischen Makromolekülen“ |
| Kōichi Tanaka (* 1959) | Japan | ||
| Kurt Wüthrich (* 1938) | Schweiz | „für seine Entwicklung der kernmagnetischen Resonanzspektroskopie zur Bestimmung der dreidimensionalen Struktur von biologischen Makromolekülen in Lösungen“ | |
| 2003 | Peter Agre (* 1949) | Vereinigte Staaten | „für die Entdeckung der Wasserkanäle in Zellmembranen“ |
| Roderick MacKinnon (* 1956) | Vereinigte Staaten | „für seine strukturellen und mechanischen Studien von Ionenkanälen in Zellmembranen“ | |
| 2004 | Aaron Ciechanover (* 1947) | Israel | „für die Entdeckung des Ubiquitin-gesteuerten Proteinabbaus“ |
| Avram Hershko (* 1937) | Israel (geb. in Karcag, Ungarn) | ||
| Irwin Rose (1926–2015) | Vereinigte Staaten | ||
| 2005 | Yves Chauvin (1930–2015) | Frankreich | „für die Entwicklung der Metathese-Methode in der organischen Synthese“ |
| Robert Grubbs (1942–2021) | Vereinigte Staaten | ||
| Richard R. Schrock (* 1945) | Vereinigte Staaten | ||
| 2006 | Roger D. Kornberg (* 1947) | Vereinigte Staaten | „für seine Arbeiten über die molekularen Grundlagen der Gentranskription in eukaryotischen Zellen“ |
| 2007 | Gerhard Ertl (* 1936) | Deutschland | „für seine Studien von chemischen Verfahren auf festen Oberflächen“ |
| 2008 | Osamu Shimomura (1928–2018) | Vereinigte Staaten (geb. in Kyōto, Japan) | „für die Entdeckung und Weiterentwicklung des grün fluoreszierenden Proteins“ |
| Martin Chalfie (* 1947) | Vereinigte Staaten | ||
| Roger Tsien (1952–2016) | Vereinigte Staaten | ||
| 2009 | Venkatraman Ramakrishnan (* 1952) | Vereinigtes Königreich (geb. in Chidambaram, Tamil Nadu, Indien) | „für die Studien zur Struktur und Funktion des Ribosoms“ |
| Thomas A. Steitz (1940–2018) | Vereinigte Staaten | ||
| Ada Yonath (* 1939) | Israel |
Gewinner Nobelpreis für Chemie 2010 bis 2019
| Jahr | Person | Land | Begründung für die Preisvergabe |
|---|---|---|---|
| 2010 | Richard F. Heck (1931–2015) | Vereinigte Staaten | „für Palladium-katalysierte Kreuzkupplungen in organischer Synthese“ |
| Ei-ichi Negishi (1935–2021) | Japan | ||
| Akira Suzuki (* 1930) | Japan | ||
| 2011 | Dan Shechtman (* 1941) | Israel | „für die Entdeckung der Quasikristalle“ |
| 2012 | Robert Lefkowitz (* 1943) | Vereinigte Staaten | „für ihre Studien zu G-Protein-gekoppelten Rezeptoren“ |
| Brian Kobilka (* 1955) | Vereinigte Staaten | ||
| 2013 | Martin Karplus (* 1930) | Vereinigte Staaten (geb. in Wien, Österreich) | „für die Entwicklung von Multiskalen-Modellen für komplexe chemische Systeme“ |
| Michael Levitt (* 1947) | Vereinigte Staaten/ Vereinigtes Königreich/ Israel (geb. in Pretoria, Südafrika) | ||
| Arieh Warshel (* 1940) | Vereinigte Staaten/ Israel | ||
| 2014 | Eric Betzig (* 1960) | Vereinigte Staaten | „für die Entwicklung von superauflösender Fluoreszenzmikroskopie“ (Photoactivated Localization Microscopy, STED-Mikroskop) |
| Stefan Hell (* 1962) | Deutschland (geb. in Sântana, Rumänien) | ||
| William Moerner (* 1953) | Vereinigte Staaten | ||
| 2015 | Tomas Lindahl (* 1938) | Schweden | „für mechanistische Studien der DNA-Reparatur“ |
| Paul Modrich (* 1946) | Vereinigte Staaten | ||
| Aziz Sancar (* 1946) | Vereinigte Staaten/ Türkei | ||
| 2016 | Jean-Pierre Sauvage (* 1944) | Frankreich | „für den Entwurf und die Synthese Molekularer Maschinen“ |
| Fraser Stoddart (* 1942) | Vereinigtes Königreich/ Vereinigte Staaten | ||
| Ben Feringa (* 1951) | Niederlande | ||
| 2017 | Jacques Dubochet (* 1942) | Schweiz | „für die Entwicklung der Kryo-Elektronenmikroskopie für die hochauflösende Strukturerkennung von Biomolekülen in Lösung“ |
| Joachim Frank (* 1940) | Vereinigte Staaten/ Deutschland | ||
| Richard Henderson (* 1945) | Vereinigtes Königreich | ||
| 2018 | Frances H. Arnold (* 1956) | Vereinigte Staaten | „für die gerichtete Evolution von Enzymen“ |
| George P. Smith (* 1941) | Vereinigte Staaten | „für das Phagen-Display von Peptiden und Antikörpern“ | |
| Gregory Winter (* 1951) | Vereinigtes Königreich | ||
| 2019 | John B. Goodenough (1922–2023) | Vereinigte Staaten (geb. in Jena, Deutschland) | „für die Entwicklung von Lithium-Ionen-Batterien“ |
| M. Stanley Whittingham (* 1941) | Vereinigtes Königreich/ Vereinigte Staaten | ||
| Akira Yoshino (* 1948) | Japan |
Gewinner Nobelpreis für Chemie 2020 bis 2024
| Jahr | Person | Nationalität | Begründung für die Preisvergabe |
|---|---|---|---|
| 2020 | Emmanuelle Charpentier (* 1968) | Frankreich | „für die Entwicklung einer Methode zur Genom-Editierung“ (CRISPR/Cas-Methode) |
| Jennifer A. Doudna (* 1964) | Vereinigte Staaten | ||
| 2021 | Benjamin List (* 1968) | Deutschland | „für die Entwicklung der asymmetrischen Organokatalyse“ |
| David MacMillan (* 1968) | Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten | ||
| 2022 | Carolyn Bertozzi (* 1966) | Vereinigte Staaten | „für die Entwicklung der Click-Chemie und der bioorthogonalen Chemie“ |
| Morten P. Meldal (* 1954) | Dänemark | ||
| Barry Sharpless (* 1941) | Vereinigte Staaten | ||
| 2023 | Moungi Bawendi (* 1961) | Vereinigte Staaten, Tunesien (geb. in Paris, Frankreich) | „für die Entdeckung und Entwicklung von Quantenpunkten“ |
| Louis Brus (* 1943) | Vereinigte Staaten | ||
| Alexei Iwanowitsch Jekimow (* 1945) | Russland | ||
| 2024 | David Baker (* 1962) | Vereinigte Staaten | „für rechnergestütztes Proteindesign“ |
| Demis Hassabis (* 1976) | Vereinigtes Königreich | „für die Vorhersage der komplexen Strukturen von Proteinen“ | |
| John M. Jumper (* 1985) | Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich |
Bisher sind in der Geschichte des Chemie-Nobelpreises sieben Frauen ausgezeichnet worden. Einige davon kannst du in unserem Artikel über bedeutende Chemikerinnen kennenlernen.
Henri Moissan (1906)
Ferdinand Frederic Henri Moissan (1852-1907) war ein französischer Chemiker, der sich hauptsächlich mit chemischen Verbindungen und deren Zerlegung. Ein Ziel seiner Arbeiten war die Herstellung künstlicher Diamanten. Es ist zwar umstritten, ob es ihm tatsächlich selbst gelungen ist, aber seine Erkenntnisse und Methoden kommen seit den 1950er-Jahren in der industriellen Produktion von Kunstdiamanten zum Einsatz.
Den Nobelpreis für Chemie erhielt Henri Moissan für zwei bedeutende und zukunftsweisende Errungenschaften. Ihm gelang es als Erster das Halogen Fluor zu isolieren und zu charakterisieren. Moissan Entdeckung ermöglichte die massenhafte Produktion von elementarem Fluor, das heute in vielen Bereichen zum Einsatz kommt; in seiner reinen Form oder in Verbindung mit anderen Elementen.

Da schon kleinste Spuren von Fluor einen positiven Effekt auf den Zahnschmelz von Menschen und Tieren hat, wird es in Salzverbindungen Zahnpasten, Speisesalz und teilweise auch dem Trinkwasser beigefügt. Organische Fluorverbindungen werden wegen ihrer wasser-, fett- und schmutzabweisenden Eigenschaften in vielen Alltagsgegenständen verarbeitet. Man findet sie beispielsweise in wetterfester Bekleidung und Teflon-Pfannen.
Die zweite außerordentliche Leistung von Henri Moissan, die mit dem Nobelpreis gewürdigt wurde, war die Entwicklung und Einführung eines elektrischen Lichtbogenofens. Mit diesem können Temperaturen von bis zu 3500 °C erreicht werden und so fast alle chemischen Verbindungen in Dampf aus den einzelnen Elementen zu verwandeln, die sich bei der Abkühlung zu neuen Verbindungen zusammensetzen können. Der Moissan-Ofen ermöglichte in der Folge zahlreiche wichtige Entdeckungen und daraus resultierende Entwicklungen.

Ernest Rutherford (1908)
Der in Neuseeland geborene Ernest Rutherford (1871-1937) war ein Experimentalphysiker, der insbesondere im Bereich der Atomphysik forschte. Voraussetzung für sein Wirken war die Entdeckung der natürlichen Radioaktivität durch Henri Becquerel. Mit Hilfe der Strahlen, die er je nach Durchdringungsvermögen in Alpha- und Beta-Strahlen unterschied, untersuchte Rutherford die Ionisation von Gasen.
In den Jahren 1909 bis 1911 entwickelte auf der Grundlage seiner Untersuchungen das sogenannte rutherfordsche Atommodell, das Ausgangspunkt für das bis heute gültige Bild des Atoms ist. Rutherford sprach als Erster von einem kleinen, positiv geladenen Atomkern, der fast die ganze Masse des Atoms besitzt.
Den Nobelpreis für Chemie erhielt Rutherford aber bereits 1908 für seine Untersuchungen der Radioaktivität; ein Forschungsfeld in dem sich Chemie und Physik überschneiden. Im Laufe der Zeit wurden gerade auf diesem Gebiet immer wieder Physiker*innen für Leistungen in der Chemie und Chemiker*innen für Errungenschaften in der Physik gewürdigt.
Bei der ausgezeichneten Arbeit ging es konkret um den Zerfall der Elemente und die Chemie der radioaktiven Stoffe. Rutherford hebelte damit die vorherrschende Überzeugung, dass chemische Elemente unzerstörbar seien, auf. Aus seinen Untersuchungen zum Zerfall radioaktiver Atome leitete er den Begriff der Halbwertszeit ab.
Wenn du die Grundlagen dazu vertiefen möchtest, ist chemie nachhilfe online eine flexible Möglichkeit.
Finde deine Nachhilfe Chemie in Duisburg.
Fritz Haber (1918; verliehen 1919)
Der deutsche Chemiker Fritz Jakob Haber wurde 1868 in Breslau geboren. Im Laufe seines Schaffens hat er sich mit den verschiedensten Teilbereichen wie der Thermochemie, der Organischen Chemie, der Elektrochemie und der Technischen Chemie auseinandergesetzt. Fritz Haber ist eine umstrittene Figur, die häufig als Sinnbild für das Versagen der Wissenschaft verwendet wird.

Tatsächlich leistete er aber auch einen bedeutenden Beitrag zur Sicherung der Ernährung der Weltbevölkerung. Andererseits gilt er als „Vater des Gaskriegs“, da er sich zu Beginn des Ersten Weltkriegs dem Kriegsministerium freiwillig als wissenschaftlicher Berater zur Verfügung stellte. In dieser Funktion experimentierte er mit den Giftgasen Chlor und Phosgen ihrem Einsatz als Kriegswaffen. Am ersten Gasangriff des Deutschen Heers war er persönlich beteiligt, indem er die Vorbereitungen überwachte und Anweisungen zur Positionierung der Gasflaschen gab.
Bereits vor dem Krieg hatte Fritz Haber aber eine ganz andere Entdeckung gemacht, die des Nobelpreises durchaus würdig ist. Im Jahr 1908 gelang ihm die Synthese von Ammoniak aus den Elementen Stickstoff und Wasserstoff.
Gemeinsam mit dem Chemiker und Industriellen Carl Bosch entwickelte er daraus das sogenannte Haber-Bosch-Verfahren, das die Massenproduktion Kunstdünger auf Stickstoffbasis ermöglicht. Bis heute wird durch diese Erfindung die Ernährung eines großen Teils der Weltbevölkerung sichergestellt. Wenn du dazu Übungsaufgaben brauchst, kann chemie nachhilfe münchen eine passende Anlaufstelle sein.
Nachdem wir dir drei frühe Preisträger des Chemie-Nobelpreises vorgestellt haben, wollen wir den Blick auf Chemiker werfen, denen der Preis innerhalb der letzten knapp 30 Jahren verliehen wurde.
Wie wäre es mit Chemie-Nachhilfe privat?
Paul J. Crutzen, Mario J. Molina und Frank Sherwood Rowland(1995)
Der Niederländer Paul Josef Crutzen (1933-2021) war als Meteorologe und Atmosphärenchemiker einer der Ersten, der vor dem menschgemachten Klimawandel warnten und zu drastischen Maßnahmen aufrief. Gemeinsam mit seinem Kollegen John W. Birks veröffentlichte Crutzen 1982 eine Abhandlung zur Theorie des Nuklearen Winters, die erste Veröffentlichung mit diesem Thema überhaupt. Der Nukleare Winter bezeichnet die Verdunkelung und Abkühlung der Erdatmosphäre, die durch eine große Anzahl von Kernwaffenexplosionen verursacht werden könnte.
Bereits in den 1960er Jahren hat Paul J. Crutzen die Bedeutung von Spurengasen untersucht und 1970 aufgezeigt, dass Distickstoffmonoxid (allgemein bekannt als Lachgas) langlebig genug ist, um die Stratosphäre zu erreichen. Dort wird es zu Stickstoffmonoxid umgewandelt und zerstört in einem katalytischen Zyklus mit Stickstoffoxid Ozon.

Basierend auf diesen Erkenntnissen führten die Chemiker Mario J. Molina (1943-2020) Frank Sherwood Rowland (1927-2012) Studien durch, in denen sie unter anderem die chemischen Reaktionen, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) in der Stratosphäre auslösen können, untersuchten. FCKW-Verbindungen kommen in der Natur nicht vor, sie werden ausschließlich von Menschen künstlich hergestellt.
Die breite Öffentlichkeit, die Politik und die Industrie nahmen die Ergebnisse und daraus folgenden Warnungen erst ernst, als 1985 Beweise für die Existenz des Ozonlochs gefunden wurden. Paul J. Crutzen lieferte daraufhin die Erklärungen über die chemischen und physikalischen Grundlagen seiner Entstehung. Die drei Chemiker wurden für ihre wichtigen Erkenntnissen, die weitreichende politische Auswirkungen hatten, 1995 mit dem Chemie-Nobelpreis geehrt.
Finde deine Chemie Nachhilfe Kaiserslautern.
John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham und Akira Yoshino (2019)
Im Jahr 2019 wurde der Chemie-Nobelpreis für eine Erfindung verliehen, die aus unserem Alltag kaum mehr wegzudenken ist. Der britisch-amerikanische Chemiker (geb. 1941), der US-amerikanische Physiker und Materialwissenschaftler John Bannister Goodenough (geb. 1922 in Deutschland) sowie der japanische Ingenieur Akira Yoshino (geb. 1948) teilten sich den Preis für die Entwicklung der Lithium-Ionen-Batterie.

In allen tragbaren Geräten wie Notebooks, Handys oder Digitalkameras sowie in E-Bikes und Elektroautos werden heutzutage nur noch Lithium-Ionen-Akkus verbaut, da sie selbst bei geringer Größe und Gewicht eine hohe Energieleistung haben. Für Schüler*innen und Studierende, die das Thema vertiefen wollen, kann chemie nachhilfe eine gute Ergänzung sein.
Den Grundstein für die Entwicklung legte Stanley Whittingham in den 1970er Jahren während der Öl-Krise. Auf der Suche nach sogenannten Supraleitern entdeckte er Titandisulfid als ausreichend energiereiches Kathodenmaterial für Lithium-Batterien. Die so gebauten Batterien waren aber nicht für den alltäglichen Einsatz geeignet, da sie sehr explosionsanfällig waren.
John B. Goodenough gelang 1980 schließlich der Durchbruch zu einer noch leistungsfähigeren Batterie, die zudem auch noch sicher ist. Er vermutete, dass ein Metalloxid deutlich effizienter sei als ein Metallsulfid und führte eine systematische Suche nach dem geeigneten Kathodenmaterial durch. Schließich fand er mit Kobaltoxid ein Material, mit dem das Potenzial der Batterie vervierfacht werden konnte.
Auf Grund von Goodenoughs Erkenntnissen begann Akira Yoshino 1981 mit der Entwicklung eines kommerziell verwertbaren Akkus. Vier Jahre später hatte er ein Produkt geschaffen, bei dem die Anode aus einem Kohlenstoffmaterial besteht, das Lithiumionen aufnehmen kann. 1991 kam schließlich die erste Lithium-Ionen-Batterie auf den Markt. Wenn du in der Hauptstadt lernst, findest du Unterstützung über chemie nachhilfe berlin.
Viel Spaß beim Entdecken! Wenn du an der Küste lernst, ist chemie nachhilfe ebenfalls eine Option.
Mit KI zusammenfassen: