„Der Nachahmungstrieb ist dem Menschen von Kindheit angeboren, und dadurch unterscheidet er sich von den übrigen lebenden Wesen, dass er am meisten Lust zur Nachahmung hat und dass er seine ersten Fähigkeiten durch Nachahmung erwirbt.“
Aristoteles
Die Entstehung des antiken Dramas und Theaters sind eng miteinander verknüpft. Mit den neuen Formen und Inhalten entwickelten sich auch deren Darstellung.
Tauche mit uns ein in die Anfänge der Theatergeschichte. Wie sahen die ersten Theaterbauten aus? Wie viele Schauspieler standen auf der Bühne du welche Kostüme trugen sie? Hier erfährst Du alles über das antike griechische Theater und die Aufführungspraxis. Falls du zudem Unterstützung im Deutschunterricht benötigst, empfehlen wir nachhilfe deutsch.
Steckst du kurz vor dem Abi und bräuchtest dringend Unterstützung im Deutschunterricht? Auf zum Beispiel Nachhilfe Deutsch Düsseldorf findest du viele super Lehrer - du kannst aber auch nach vielen anderen Regionen suchen!
Aber jetzt zurück zum Anfang...

Entstehung des griechischen Theaters
Die Entstehung des griechischen Theaters geht auf die rituellen Maskentänze und Chorgesänge während der Dionysien im 6. Jahrhundert v. Chr. zurück. Die Dionysien waren ein jährlich stattfindendes Fest zu Ehren des Dionysos, der griechische Gott des Weines und der Ekstase.
Zu Beginn fanden diese Festspiele als Umzüge statt, bei denen ein Chor Lobgesänge auf den Weingott sang und ekstatische Tänze aufführte. Ab 534 v. Chr. wurde dem Chor ein einzelner Schauspieler gegenübergestellt, der in einen Dialog mit ihm trat; das gilt als Geburtsstunde der griechischen Tragödie.
Inhaltlich ging es dabei nicht mehr darum, den Gott zu preisen, sondern anhand von Geschichten aus der Mythologie das Publikum zu bilden und philosophische und ethische Fragen aufzuwerfen.
In der Stadt Athen wurden einmal jährlich die städtischen Dionysien abgehalten, bei denen neben Opferritualen und Prozessionen auch einen Dramenwettbewerb (Agon) stattfand.
Es wurden drei Dichter ausgewählt, die gegeneinander antraten. Jedem stand ein ganzer Aufführungstag zur Verfügung, an dem er eine Tetralogie aus drei Tragödien und einem Satyrspiel zeigte. Die dritte Form des antiken Dramas ist die Komödie. Bei den Komödienwettbewerben traten fünf Dichter mit je einem Stück gegeneinander an.

Die Aufführungen wurden aufwändiger, es wurden ein zweiter und wenig später ein dritter Schauspieler eingeführt und immer mehr Menschen strömten herbei, um das Spektakel zu sehen. Deshalb wurden schließlich die ersten Theater gebaut.
Obwohl die Aufführungen immer noch im Rahmen der Festspiele zu Ehren des Dionysos stattfanden, trat der religiös kultische Zweck zunehmend in den Hintergrund. Das Theater entwickelte sich zu einem Ort der Selbstdarstellung des Staates. Er finanzierte die die Festspiele zu einem großen Teil, die entstehende Demokratie war nicht nur Thema der gezeigten Theaterstücke, sondern wurde wahrscheinlich auch von ihnen beeinflusst.
Antikes Theater ist auch immer wieder im Deutschunterricht Thema. Falls Deutsch nicht deine Stärke ist, kannst du dich in deiner Region nach Nachhilfeunterricht umschauen, zum Beispiel auf Deutsch Nachhilfe Köln!
Die Architektur der antiken Theater
In den ersten Theatern nahmen die Zuschauer auf Holzsitzen Platz. Die ersten dauerhaften Theaterbauten entstanden um 499 v. Chr. Sie wurden an einen Hügel gebaut, in den die steinernen Sitzreihen eingelassen wurden.
Die antiken Theater sind Freiluftbühnen; sie haben also keine Wände und kein Dach. Die Bühne ist rund und die Zuschauerreihen sind trichterförmig um sie herum angeordnet.
Das Dionysos-Theater in Athen fasste bis zu 17.000 Zuschauer und diente als Vorbild für viele spätere Theaterbauten.
- Theatron: die Sitzreihen für das Publikum
- Orchestra: die runde Spielfläche für den Chor; in der Mitte stand der Dionysosaltar
- Skene: das Bühnenhaus (erst aus Holz, später aus Stein) außerhalb der Orchestra; hier konnten sich die Schauspieler umziehen und Requisiten aufbewahrt werden; die Fassade wurde teilweise mit Farben angemalt und in das Spiel einbezogen
- Proskenion: ein schmaler Streifen zwischen Orchestra und Skene; die Spielfläche für die Schauspieler
- Logeion: ein erhöhter Sprechplatz für die Schauspieler; über dem Proskenion
- Paradoi: zwei seitliche Eingänge, durch die der Chor auftrat
Das Theater von Epidauros ist der heute noch am besten erhaltene Theaterbau der griechischen Antike. Es wurde im 4. Jahrhundert v. Chr. nach dem Vorbild des Athener Dionysos-Theaters gebaut und bot Platz für 9.000 Zuschauer. Nach dem Ausbau im 2. Jahrhundert fanden bis zu 14.000 Leute darin Platz.

Berühmt ist das Theater von Epidauros vor allem für seine hervorragende Akustik. Selbst in der hintersten Sitzreihe ist klar und deutlich zu verstehen, was in der Bühnenmitte geflüstert wird. Sogar dann, wenn im Zuschauerraum munter geredet und gegessen wird.
Die Sitzreihen sind so gebaut, dass sie diese störenden Nebengeräusche schlucken und nur die höheren Frequenzen durchdringen und verstärkt werden. Außerdem ist das Theater so ausgerichtet, dass der Wind das Phänomen unterstützt.

Die Aufführungspraxis
In der Blütezeit des antiken Theaters wurden hunderte, wenn nicht tausende Tragödien geschrieben und aufgeführt. Von den bekanntesten antiken Dichtern Euripides, Aischylos und Sophokles, die alle mindestens 90 (Sophokles sogar 123) Tragödien verfasst haben sollen, sind insgesamt nur 31 vollständig erhalten.
Die Stücke waren für eine einmalige Aufführung im Rahmen der Dramenwettbewerbe bei den Dionysien gedacht. Erst 386 v. Chr. wurde ein Gesetz erlassen, dass die Wiederaufführung der alten Stücke von Sophokles, Aischylos und Euripides erlaubte.
Die Beteiligten
In den Anfängen des griechischen Theaters hatten die Dichter die alleinige Verantwortung für alle Bereiche der Aufführung. Sie waren also auch als Regisseure und Choreografen tätig und standen als Schauspieler auf der Bühne.
Dabei stand ihnen ein Chorege zur Seite, ein wohlhabender Bürger Athens, der für die Ausstattung und den Unterhalt des Chores zuständig war. Ein Chorege war also gewissermaßen der Sponsor einer Theateraufführung und wurde jeweils von dem amtierenden Archon (einer der höchsten Beamten der Stadt Athen) ernannt. Die Funktion des Choregen war sehr prestigeträchtig. Meist wurde sein Name noch vor dem des Dichters erwähnt.
Gegen Ende 5. Jahrhunderts v. Chr. fand eine zunehmende Spezialisierung und Professionalisierung statt. Sophokles gilt als der erste Dichter, der nicht mehr selbst als Schauspieler auf der Bühne stand und der Komödiendichter Aristophanes soll immer häufiger die Regie an andere Personen abgegeben haben. Für individuelle Unterstützung im Deutschunterricht empfehlen wir zudem nachhilfe deutsch privat.
Die Spezialisierung führte dazu, dass ab 449 v. Chr. im Rahmen der städtischen Dionysien auch Schauspielerwettbewerbe durchgeführt wurden, die in der Folge an Bedeutung gewannen.
Der Chor wurde aus Laien zusammengestellt und probte unter der Leitung eines Chorführers. In der Tragödie bestand der Chor aus 12-15 Sängern, in der Komödie waren es 24, im Satyrspiel 12 maskierte Chormitglieder. Im Chor wie auch als Schauspieler waren ausschließlich Männer zugelassen.
Über die Spielweise im antiken Theater ist sehr wenig bekannt. Da die Schauspieler Masken trugen, ist ein Spiel durch die Mimik nicht möglich. Es wird daher davon ausgegangen, dass der Vortrag des Textes im Vordergrund stand.

In den ersten griechischen Tragödien stand nur ein einzelner Schauspieler dem Chor gegenüber. Aischylos führte einen zweiten, Sophokles einen dritten Schauspieler ein. Das bedeutet, dass sich in den Stücken nie mehr als drei Figuren gleichzeitig begegnen konnten.
Da aber in den meisten Stücken mehr Figuren vorkommen, musste jeder Schauspieler mehrere Rollen übernehmen. Gleichzeitig musste teilweise eine Rolle auf zwei Schauspieler aufgeteilt werden.
Masken und Kostüme
Jeder Schauspieler spielte mehrere Rollen und auch die Frauenfiguren wurden von Männern gespielt. Für jede Figur eines Stücks wurde deshalb eine Maske angefertigt, sodass für das Publikum ganz einfach zu erkennen war, in welcher Rolle ein Schauspieler gerade auf der Bühne steht.
Die Masken bedeckten den ganzen Kopf und stellten auch die Haare und Kopfbedeckungen dar. Im Gesicht befanden sich große Löcher auf Höhe der Augen und des Mundes. Die Masken wurden unterschiedlich bemalt. Frauen hatten einen hellen, Männer einen dunkleren Teint.
Während in der Komödie Masken mit lachendem Gesicht zum Einsatz kamen, waren es in der Tragödie traurige bis schreckverzerrte Gesichtsausdrücke. In beiden Fällen war der Ausdruck stark übertrieben, und somit auch aus großer Distanz eindeutig zu erkennen. Auch die Kostüme unterschieden sich in Tragödie und Komödie.
In der Tragödie war die Grundbekleidung der Chiton. Ein rechteckiges Tuch, das mit Spangen befestigt wurde und die Alltagskleidung im antiken Griechenland war. Je nach gesellschaftlichem Status, Alter und Geschlecht der Figur wurde dieses Grundkostüm mit Farben, Schmuck und Verzierungen differenziert gestaltet.
Die großen tragischen Helden trugen ein langes, weites Prachtgewand mit langen Ärmeln. Typisch für das Kostüm tragischer Rollen war auch der Kothurn; ein geschnürter wadenhoher Stiefel. Die Kothurne hatten dicke Sohlen, sodass die Schauspieler, die sie trugen größer wirkten und sich über die anderen erhoben.
In der Komödie wurden enganliegende, hautfarbene Kostüme getragen, bei denen Bauch und Gesäß übertrieben ausgestopft wurden. Männliche Figuren trugen dazu einen übergroßen erigierten Phallus, der von dem kleinen Gewand oder Mantel keinesfalls verdeckt werden wurde. Frauenfiguren eine stark stilisierte Alltagskleidung aus einem knöchellangen Gewand und einem Mantel.
In der Alten Komödie wurden ausschließlich leichte Sandalen mit sehr dünnen Sohlen getragen oder barfuß gespielt.
Das Bühnenbild
Die antiken Tragödien spielten zumeist innerhalb eines Tages an einem einzigen Ort. Dadurch waren keine großen Umbauten des Bühnenbildes nötig. Die Skene konnte bemalt werden und stand für die Außenfassade eines Hauses.

Um darzustellen, was im Inneren des Gebäudes geschah oder zur Erzeugung von Spezialeffekten standen verschiedene Geräte und Maschinen zur Verfügung.
- Ekkyklêma: diente dazu Geschehnisse, die außerhalb des Bühnenbildes stattfanden dazustellen; wie das genau aussah ist umstritten:
- erste Theorie: ein Wagen, der im richtigen Moment auf die Bühne gefahren wurde
- zweite Theorie: ein Bild, das von Anfang an auf der Bühne stand, aber erst in der entsprechenden Szene enthüllt wurde
- Mechane: eine kranähnliche Maschine, die den plötzlichen Auftritt, das Hereinschweben einer Gottheit erlaubte, um der Geschichte eine Wendung zu geben (Deus ex machina)
- Pinakes: die Zwischenräume zwischen den Säulen des Proskenions, in die Bilder gehängt wurden; z.B. um Landschaften darzustellen
- Periaktoi: drehbare Prismen, die an den drei Wänden bemalt waren und einen schnellen Bühnenbildwechsel erlaubten
Das Publikum
Das Theater wurde im antiken Griechenland vom Staat organisiert, gefördert und unterstützt. Es war allen freien Bürgern aus allen Gesellschaftsschichten zugänglich. Sklaven durften die Aufführungen nur dann besuchen, wenn sie von ihren Herren als Begleitung mitgebracht wurden. Frauen hatten zwar Zutritt zu den Theatern, mussten aber in geschlossenen Gruppen in den hintersten Reihen sitzen.
Ab dem Ende des 5. Jahrhunderts wurde der Eintritt kostenpflichtig. Ärmere Bürger erhielten jedoch vom Staat ein Theatergeld, das ihnen der Besuch der Aufführungen ermöglichte.
Da innerhalb eines Tages drei Tragödien und ein Stayrspiel gezeigt wurden, ist davon auszugehen, dass die Theatervorstellungen viele Stunden lang dauerten. Sie waren ein gemeinschaftliches Ereignis, zu dem sich die Zuschauer Essen und Trinken mitbrachten und sich wahrscheinlich auch miteinander unterhielten.
Trotzdem war die Aufmerksamkeit hoch und Reaktionen wie Zwischenrufe, Pfiffe und Stampfen keine Seltenheit. Es soll auch immer wieder zu Unruhen vor und nach den Vorstellungen gekommen sein, bei denen die Ordnungskräfte eingreifen mussten und unbeliebte Schauspieler seien mit getrockneten Früchten beworfen worden.
Das antike Theater ist ein Schwerpunkt im gymnasialen Deutschunterricht. Deutsch liegt dir einfach nicht? Nachhilfeunterricht findest du auf Nachhilfe Deutsch Frankfurt oder suche nach Unterstützung in deiner Gegend!
Die Tragödientheorie von Aristoteles
Ab dem 5. Jahrhundert v. Chr. hatte sich schließlich eine feste literarische Form der Tragödie herausgebildet. Ab dieser Zeit erlebte das griechische Drama seine Blütezeit, die knapp hundert Jahre andauerte. Wenn du auch dein Deutsch verbessern möchtest, könnte nachhilfe deutsch heidelberg hilfreich sein.
Der Universalgelehrte, Philosoph und Naturforscher, Aristoteles verfasste im 4. Jahrhundert v. Chr. seine Theorie der Dichtung, die Poetik. Darin beschreibt er sehr genau die Geschichte, den Aufbau und die Wirkung des antiken Dramas.
Dabei handelt es sich um Beobachtungen, die rückblickend gemacht wurden. Aristoteles Schrift hatte also keinen Einfluss auf die Entwicklung des antiken Theaters selbst, wird aber bis heute als Grundlage zur Analyse der alten Texte der antiken Literatur und hat die neuzeitlichen Literatur-Theorien und Theater-Formen beeinflusst.
Mimesis
Einer der zentralen Begriffe in der aristotelischen Poetik ist die Mimesis; die Nachahmung der Wirklichkeit. Aristoteles geht davon aus, dass jeder Mensch einen angeborenen Nachahmungstrieb hat, der ihm das Lernen ermöglicht und das die Menschen sehr viel Spaß am Nachahmen haben und dabei auch gerne Dinge darstellen, die wir in der Wirklichkeit ungerne sehen.
Laut Aristoteles ist jede Form von Literatur eine Nachahmung der Wirklichkeit; denn es wird etwas erzählt, dass wahrscheinlich so geschehen könnte. Im Gegensatz dazu sieht er die Geschichtsschreibung, die detailliert aufzeichnet, was tatsächlich geschehen ist.
Die Dichtung kann somit Fragen stellen und reflektieren, wie man sich in einer bestimmten Situation verhalten sollte, ohne dass diese jemals eingetreten ist.
In der Komödie werden die menschlichen Schwächen übertrieben dargestellt und ins Lächerliche gezogen. Die Zuschauenden lernen durch Lachen und Spotten über die Figuren. In der Tragödie hingegen treten Menschen auf, die edel handeln, aber ihrem vorherbestimmten Schicksal nicht entgehen können.
Katharsis
Durch die Tragödie sollen die Zuschauenden aufgewühlt werden und „Furcht und Mitleid“ (oder je nach Übersetzung auch „Jammer und Schauder“) empfinden. Das soll dadurch geschehen, dass ein Held gezeigt wird, mit dem sich die Zuschauenden identifizieren können und der im Laufe der Handlung ins Unglück stürzt.
Indem man sich mit ihm mitleidet, kommt es, laut Aristoteles Tragödientheorie, zu einer Reinigung von diesen Emotionen: der Katharsis.
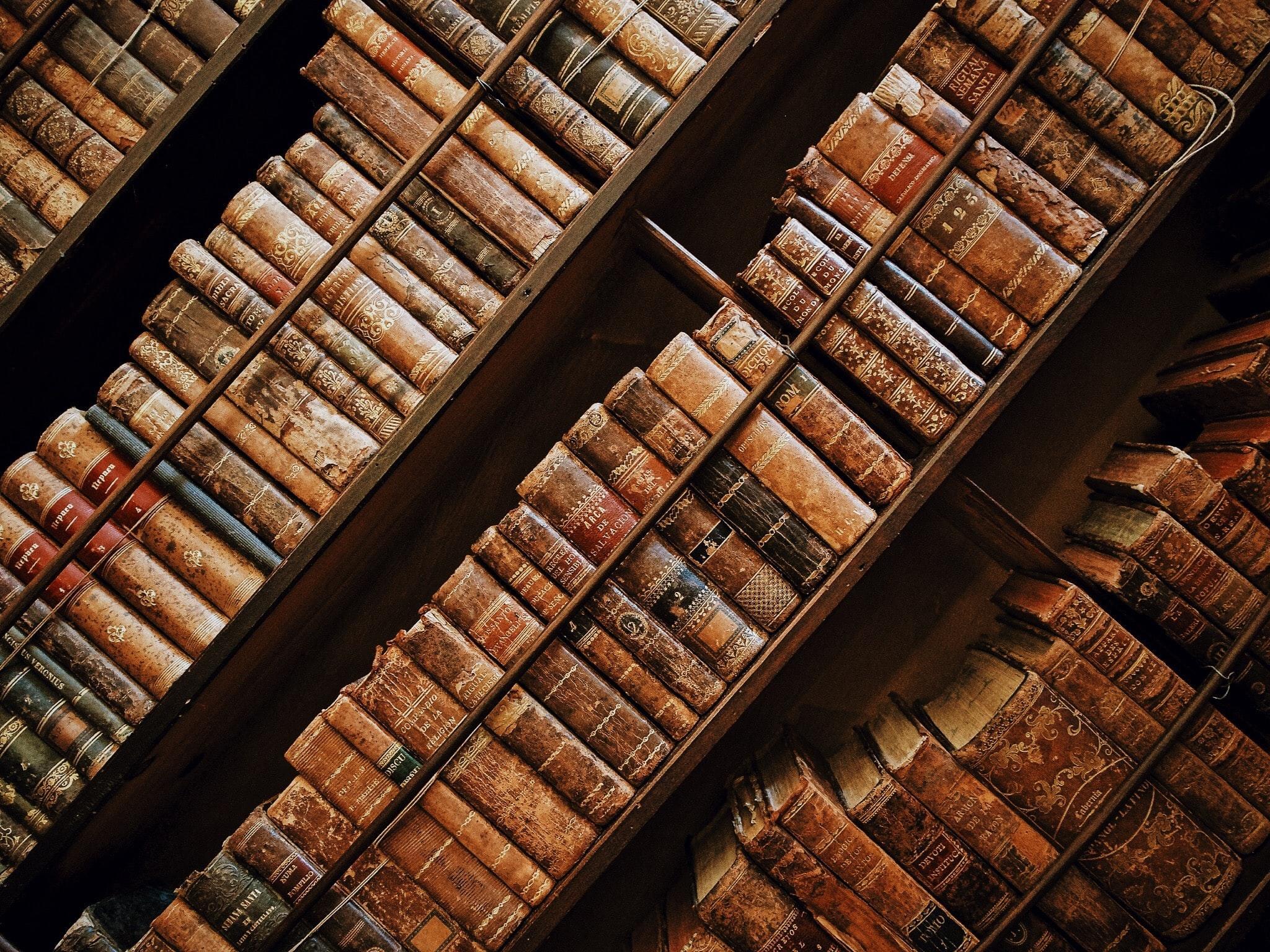
Inhalte der griechischen Tragödien
In den antiken Tragödien werden philosophische, religiöse und existentielle Fragen behandelt. Die meisten Geschichte stammen aus der Mythologie und erzählen, wie die Helden durch das Wirken der Götter oder ein vorbestimmtes Schicksal „schuldlos schuldig“ werden.
Es kommt zu einer Gegenüberstellung von:
- Mensch und Götter
- Schuld und Sühne
- Individuum und die Welt
- Charakter und Schicksal
Die Konflikte sind nicht immer durch menschliches Handeln zu lösen; eine Gottheit muss eingreifen, um die Handlung zum Abschluss zu bringen. Im antiken Theater geschah das durch eine Hebemaschine, die die Gottheit über die Bühne schweben oder auf dem Bühnendach landen ließ. Diesen oft überraschenden Auftritt nennt man Deus ex Machina (dt.: Gott aus einer Maschine).
Aufbau und Struktur der griechischen Tragödien
In der antiken Tragödie standen sich ein Chor aus 12 bis 15 Mitgliedern und zwei bis drei Schauspieler gegenüber. Der Chor hat die Funktion des Erzählers. Er beschreibt, kommentiert und teilt die Entscheidungen der Götter mit.
Die Schauspieler verkörpern die verschiedenen Figuren der Tragödie und treten in Dialog, untereinander oder mit dem Chor, und halten Monologe. Damit die Zuschauer die verschiedenen Rollen auseinanderhalten können, tragen sie Masken.
Die antiken Tragödien hatten einen strengen Aufbau, der nicht verändert werden konnte. Zu Beginn wurden teilweise in einem Prolog wichtige Informationen zu dem beginnenden Stück gegeben. Darauf folgte das Einzugslied des Chors, der Parodos.

Sobald der Chor auf der Bühne positioniert war, sang er sein erstes Stasimon (Standlied), während dem der oder die Schauspieler auftraten, die an der nächsten Szene beteiligt waren. Die Geschichte der Tragödie wurde in den Epeisodia erzählt. Über den ganzen weiteren Verlauf der Aufführung wechselten Stasima und Epeisodia ab. Abgeschlossen wurde jede Tragödie mit einem Schluss- und Auszugslied des Chors, dem Exodus.
Aristoteles beschreibt als wichtigstes Merkmal der Tragödie die geschlossene Handlung. Diese ist nicht rein dadurch gegeben, dass die Geschichte einer einzelnen Hauptfigur erzählt wird. Die Aufgabe des Dichters sei es, alles Wichtige zu erzählen und dabei alles Unwichtige wegzulassen.
Als Regel für eine geschlossene Handlung ergibt das Prinzip der drei Einheiten:
- Einheit des Ortes: Das ganze Stück spielt an einem Ort, damit das Publikum nicht durch Umbauten im Bühnenbild gestört wird. (Aristoteles formulierte dieses Prinzip noch nicht selbst aus; das geschah erst in der Renaissance. Trotzdem wird sein Ursprung oft Aristoteles und seiner Poetik zugeschrieben)
- Einheit der Zeit: Die Handlung soll innerhalb von 24 Stunden ablaufen.
- Einheit der Handlung: Die Handlung soll folgerichtig und stringent sein. Es soll keine Nebenhandlungen geben, die für die eigentliche Geschichte nicht relevant sind.
Die Tragödie sollte so aufgebaut sein, dass erst die Vorgeschichte erzählt wird, sich dann die Handlung steigert, bis sie an ihrem Höhepunkt angelangt ist. An diesem Punkt schlägt sie ins Gegenteil um und fällt ab, bis es schließlich zu einer Lösung, einer Erkenntnis kommt.
Ein beispielhaftes griechisches Drama: Die Antigone des Sophokles
Die Geschichte der Antigone entstammt dem thebanischen Sagenzyklus und spielt in der Zeit nach dem Krieg um Theben, einer der wichtigsten Städte im Griechenland der Antike. Eteokles und Polyneikes, die Brüder von Antigone, hatten um die Herrschaft gekämpft und sind beide gefallen; Eteokles als Verteidiger der Stadt, Polyneikes als Verräter. Sophokles hat sie wahrscheinlich im Jahr 442 v. Chr. in Athen uraufführen lassen.
Das staatliche Recht sieht vor, dass der Feind nicht bestattet wird; darauf beruft sich auch Kreon, der neue König Thebens, und verbietet eine Bestattung Polyneikes. Dessen Schwester Antigone beruft sich hingegen auf die göttlichen Gesetze, die verlangen, dass jeder Tote bestattet wird.
Nachdem Antigone wegen der Bestattung ihres Bruders festgenommen wurde und gesteinigt werden soll, entbrennt ein Streit zwischen Kreon und seinem Sohn Haimon, der gleichzeitig der Verlobte Antigones ist und in der Rechtsfrage auf ihrer Seite steht.

Kreon ist erst bereit, seine Meinung zu überdenken, als ihm der Seher Teiresias den Tod seines Sohnes hervorsagt; eine Strafe der Götter für die Missachtung ihrer Gesetze. Der Sinneswandel Kreons kommt jedoch zu spät. Antigone hat sich bereits aus Angst vor dem Hungertod in ihrer Zelle erhängt und auch Haimon hat sich aus Schmerz darüber das Leben genommen.
Als schließlich noch die Ehefrau Kreons den Freitod wählt, weil sie den Tod ihres Sohnes nicht verkraftet, kommt Kreon zu der Erkenntnis, dass sein Handeln hochmütig und selbstherrlich war und er sich nun der gerechten Strafe durch die Götter fügen muss.
Die Antigone des Sophokles erfüllt die aristotelischen Prinzipien der Tragödie: die Handlung ist stringent und löst sich am Ende durch eine Erkenntnis auf. Das ganze Stück spielt sich an einem einzigen Tag vor dem Königspalast ab (Einheit von Zeit und Ort).
In einem Prolog wird die Ausgangssituation erklärt und beim Einzug des Chores wird die Vorgeschichte noch einmal aufgerollt. Anschließend folgen fünf Szenen, auf die jeweils ein Stasimon folgt.
Im Schlusslied singen der Chorführer, ein Bote und Kreon im Wechsel. Der Bote berichtet über die Selbstmorde, der Chorführer erklärt, dass Kreon selbst an dem Unglück schuld sein und Kreon stimmt dem zu.
In der Tragödie Antigone prallen zwei gegensätzliche und unvereinbare Weltbilder aufeinander. Ein glücklicher Ausgang wäre nur möglich, wenn Antigone und Kreon bereit wären, sich entgegenzukommen und ihre totalitäre Position aufzugeben. Damit würden sie sich aber, in ihren eigenen Augen, den Göttern beziehungsweise dem Staat gegenüber schuldig machen. So werden sie schuldlos schuldig.
Mit KI zusammenfassen:
















Mein Vater hat immer gesagt, dass der Begriff „die Koryphäe „ eigentlich ein maskulines Wort sei
Im antiken griechischen Theater stand immer ein Mann an der Seite der Bühne und erklärte das Geschehen dort. Dieser Mann wurde „der Koryphäe „ genannt
Stimmt fas?
Hat mir echt weitergeholfen
Könntet ihr bitte euere Quellen bitte angeben, dass wäre super interessant für mich, da ich eine Seminararbeit über das Thema verfassen muss ;)
Sehr interessant! Ich habe vergessen (Abitur 1971) , wie man den Vorgang nennt, wenn zwei Schauspieler ein Geschehen außerhalb der Bühne schildern, das das Publikum nicht sehen kann, z.B., sie stehen auf der Stadtmauer, blicken nach links und schildern einen unten stattfindenden Kampf. Bitte helfen Sie mir auf die Sprünge …
Hallo Michael, danke für den Kommentar und die Frage. Der gesuchte Begriff ist „Teichoskopie“ oder „Mauerschau“.