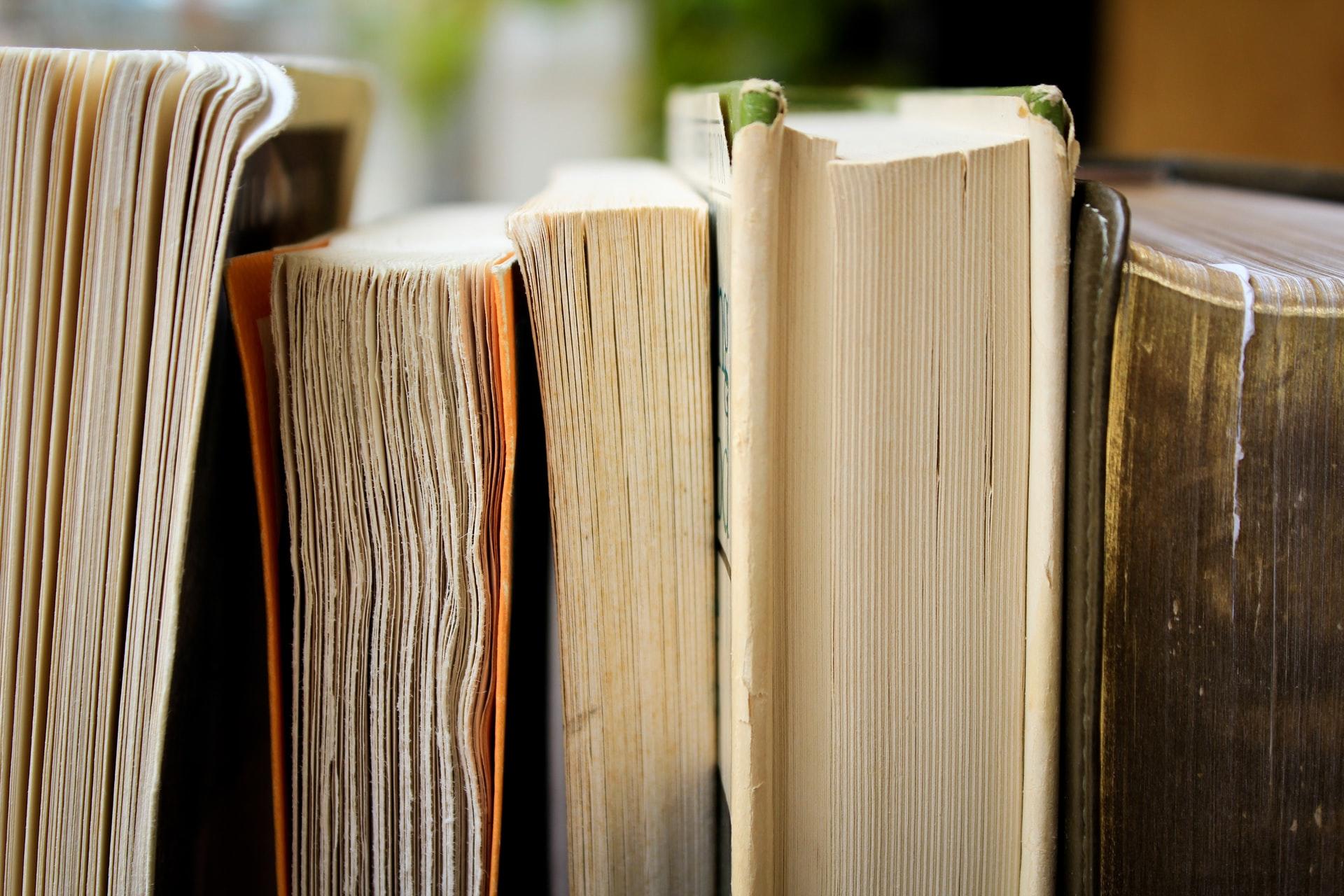So wie eine Gesellschaft stets im Wandel ist, ist es auch die Sprache. Die Wahl des "Wort des Jahres" verbindet beides miteinander und kürt stets zum Ende eines Jahres einen Begriff, der die Gesellschaft, Politik oder Kultur in diesem Jahr besonders geprägt hat.
In diesem Jahr erfährst du nicht nur mehr über die Hintergründe dieser Wahl, sondern findest auch eine komplette Liste der seit den 70er-Jahren gewählten Wörter.

Was ist das Wort des Jahres?
Seit etwa 50 Jahren entscheidet die Gesellschaft für deutsche Sprache e.V. (GfdS) über das "Wort des Jahres". Zum Ende eines jeden Jahres veröffentlicht sie in Wiesbaden das Gewinnerwort sowie die Top 10 des jeweiligen Jahres.
Welches Wort es schafft, ausgewählt zu werden, hängt nicht unbedingt davon ab, wie häufig es im Sprachgebrauch verwendet wird. Für die GfdS steht vielmehr die gesellschaftliche Relevanz im Vordergrund.
Die Liste der bisher gewählten Wörter des Jahres ähnelt daher einer kleinen Zeitreise durch die jüngere deutsche Geschichte. Jedes Wort stellt dem Vorsitzenden der GfdS, Dr. Peter Schlobinski, eine Art Zeitkapsel dar, die gesellschaftspolitische sowie kulturelle Themen und Ereignisse des Jahres widerspiegelt.
Wenn du zum Beispiel an das Jahr 2015 denkst, hast du möglicherweise zunächst keine konkreten Erinnerungen an das Jahr. Siehst du dann jedoch, dass das Wort des Jahres 2015 "Flüchtlinge" war, erinnerst du dich vielleicht direkt an die Flüchtlingswelle, die im Rahmen des Kriegs in Syrien Deutschland erreichte, an eine Bundeskanzlerin Angela Merkel, die sich mit den Worten "Wir schaffen das" mehr als zuversichtlich zeigte, und an eine riesige Hilfsbereitschaft in allen Ecken des Landes.
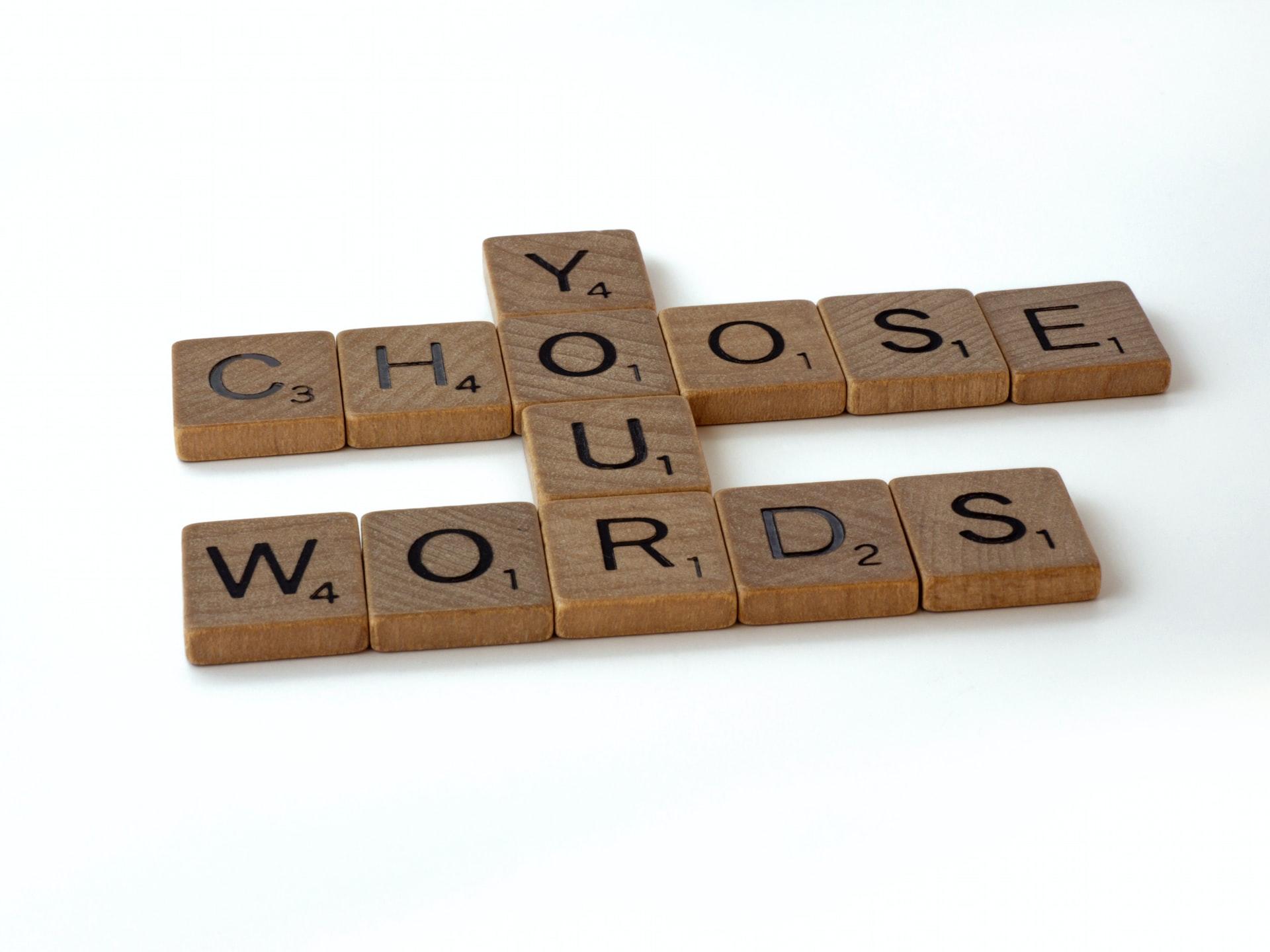
Die gewählten Wörter weisen also eine gewisse Signifikanz und Popularität auf. Sie sind ein Spiegel der Zeitgeschichte und können dabei sowohl Kulturgeschichte, politische Geschichte als auch gesellschaftspolitische Geschichte aufgreifen. Häufig trifft das Wort des Jahres einen sprachlichen Nerv der Gesellschaft und findet dadurch viel Anklang.
Für die Gesellschaft für deutsche Sprache, die hauptsächlich aus Sprachwissenschaftlern und Sprachwissenschaftlerinnen besteht, spielt darüber hinaus schon aus beruflicher Sicht die sprachliche Relevanz eines Worts eine Rolle. Die Jury-Mitglieder schauen darauf, ob es sich um eine Wortneuschöpfung handelt, ob Lehnwörter aus Fremdsprachen genutzt werden oder das Wort aus anderer Hinsicht sprachlich interessant ist.
Wie wird das Wort gewählt?
Verantwortlich für die Wahl des "Wort des Jahres" ist wie bereits erwähnt die Gesellschaft für deutsche Sprache mit Sitz in Wiesbaden. Dennoch kann sich jede und jeder an der Wahl beteiligen und das gesamte Jahr über Vorschläge für relevante Wörter bei der GfdS online einreichen.
Dafür musst du neben dem vorgeschlagenen Wort auch eine kurze Begründung verfassen, warum du dieses Wort für signifikant und relevant hältst. Solltest du eine Quelle haben, wo das Wort bereits verwendet wird, kannst du diese ebenfalls mitschicken.
Darüber hinaus sammelt die GfdS selbst ebenfalls Wörter. Aus beiden Listen mit Wortvorschlägen werden letztlich circa 130 bis 140 Wörter ausgewählt. Über diese diskutiert die Jury der Wahl nach transparenten Regeln.
Die Jury bestand in den letzten Jahren in der Regel aus dem Vorstand der GfdS, aus wissenschaftlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Gesellschaft, Medienexperten und -expertinnen sowie Kulturschaffenden. So sollen diverse Hintergründe und Sichtweisen bei der Wahl berücksichtigt werden.
Im Rahmen eines Abstimmungsverfahrens wird die Auswahl der Wörter letztlich auf 10 Wörter reduziert. Aus diesen wird dann durch die Jury das Wort des Jahres gewählt. Der Vorsitzende der GfdS teilt das Ergebnis meist im Dezember der Öffentlichkeit mit.
Ausgewählte Gewinner-Wörter der letzten Jahre
Fast 50 Mal wurde bereits ein Wort des Jahres gekürt. Eine Auswahl an spannenden und bezeichnenden Begriffen für die Ereignisse eines Jahres haben wir dir hier zusammengestellt.
2021: Wellenbrecher
2021 war das zweite Jahr in Folge, in dem die Corona-Pandemie nicht nur weite Teile des öffentlichen Lebens, sondern auch die Wahl zum Wort des Jahres bestimmt hat. Immerhin spielten mehr als 700 von insgesamt 2250 eingesandten Wörtern auf Corona an.
Der Begriff Wellenbrecher ist ursprünglich aus dem Schiffsbau und Küstenschutz bekannt. Im Frühjahr 2021 kam er auf, als sich eine vierte Corona-Welle aufbrauste und Maßnahmen ergriffen werden sollten, um diese zu stoppen. Neben den Maßnahmen stand der Begriff auch für den Zeitraum, in dem diese galten, sowie die Personen, die nach ihnen handeln.
Was in der Diskussion für die Jury letztlich mit ausschlaggebend war, war, dass der Begriff Wellenbrecher eine optimistische Note hat. Er steht für einen zuversichtlichen Blick in die Zukunft, dass auf uns zu rollende Wellen - von was auch immer - gebrochen werden können.
Auf Platz 2 landete übrigens der Ausdruck "SolidAHRität" - eine Kombination von Solidarität und dem Flussnahmen Ahr. Damit wird auf die Hochwasserkatastrophe im Ahrtal und anderen Regionen und die enorm hohe Solidarität mit den Betroffenen angespielt.
Lerne die wichtigsten Vokabeln im Deutsch Privatkurs in Frankfurt.

2020: Corona-Pandemie
Wenig überraschend war die Wahl im Jahr 2020. Gefühlt ist in diesem Jahr nichts passiert, außer der Corona-Pandemie - auch wenn das natürlich nicht ganz richtig ist. Dennoch hat sie öffentliche Diskussionen und das alltägliche Leben geprägt wie nichts anderes in den letzten Jahren.
Auch die restlichen Wörter der Top 10 stammten zuhauf aus dem Corona-Thema: Lockdown (Platz 2), Verschwörungserzählung (Platz 3), AHA (Platz 5), systemrelevant (Platz 6), Triage (Platz 7), Geisterspiele (Platz 8), Bleiben Sie gesund! (Platz 10). Nichts mit Corona zu tun hatten immerhin "Black Lives Matter" (Platz 4) und Gendersternchen (Platz 9).
Brauchst du einen Deutsch Lehrer online?
2016: Postfaktisch
Im Jahr 2016 hat es "postfaktisch" geschafft, zum Wort des Jahres gewählt zu werden. Dieses ist im Grunde eine Übertragung des englischen Ausdrucks "post truth". Der Begriff spielt darauf an, dass in Politik und Gesellschaft mittlerweile stärker auf Emotionen anstatt auf Fakten gesetzt wird. Ganze Bevölkerungsgruppen bis hin zu Politikern und Politikerinnen scheinen Tatsachen ignorieren und Lügen akzeptieren zu können, um sich gegen "die da oben" zu positionieren.
Das postfaktische Zeitalter ist geprägt von gefühlten Wahrheiten und einem sinkenden Anspruch an tatsächliche Fakten und belegbare Wahrheiten. Es scheint kein Zufall zu sein, dass "postfaktisch" in dem Jahr zum Wort des Jahres wurde, in dem Donald Trump die Präsidentschaftswahl in den USA gewann.
2005: Bundeskanzlerin
Erinnerst du dich an das Jahr, als Angela Merkel Bundeskanzlerin von Deutschland wurde? Keine Sorge, ich mich auch nicht bewusst. Denn 2005 ist lange her, immerhin war sie ganze 4 Amtszeiten und damit 16 Jahre im Amt.
Warum der Begriff Bundeskanzlerin es wert ist, zum Wort des Jahres gekrönt zu werden, scheint für einige, die Anfang der 2000er Jahre geboren wurden, unerklärlich. Doch bis zum Jahr 2005 gab es diese weibliche Form in der Praxis gar nicht, war Angela Merkel doch die erste Frau, die die Position der Kanzlerin in Deutschland einnahm.
Nach dem Ende ihrer Amtszeit war es für viele wohl eher eine Umstellung, sich wieder an das männliche "Bundeskanzler" zu gewöhnen. Für das Wort des Jahres 2022 wird dies aber vermutlich trotzdem nicht reichen...
Privatlehrer für einen Deutschkurs München findest du auf Superprof.

1995: Multimedia
Aus heutiger Sicht spannend ist auch "Multimedia" als Spitzenwort von 1995. Multimedia war damals gleichbedeutend mit dem Aufbruch in eine neue Welt voller technologischer Möglichkeiten.
In unserer digitalisierten, vernetzten und webbasierten Welt denken wir bei Multimedia vielleicht an den Einsatz unterschiedlicher Medien im Web, wie Text, Bild, Video, Reel, Audio... 1995 stand das Internet noch in den Startlöchern. Nicht einmal jeder vierte Haushalt besaß überhaupt einen Computer.
So ist dieses Wort des Jahres eine Erinnerung daran, wie schnell und umfassend sich unsere Welt in den vergangenen nicht einmal 30 Jahren gewandelt hat.
1991: Besserwessi
Ein Jahr nach der offiziellen Wiedervereinigung von Ost- und Westdeutschland wurde "Besserwessi" von der GfdS zum Wort des Jahres bestimmt.
Dieses setzt sich aus den Wörtern Besserwisser, Westen und "Wessi" zusammen. Die Entscheidung wurde mit der kritischen Beschreibung der Beziehung zwischen West- und Ostdeutschen begründet. Als Besserwessi wurden Menschen aus den alten Bundesländern bezeichnet, die sich Menschen aus den neuen Bundesländern gegenüber belehrend und besserwisserisch gibt. Insbesondere in den Bereichen Politik und Wirtschaft empfanden sich wohl einige Menschen der alten Bundesländer den neuen Bundesländern überlegen.
Der Begriff Besserwessi wurde im gleichen Jahr übrigens auch zum Unwort des Jahres nominiert.
1982: Ellbogengesellschaft
Der Begriff Ellbogengesellschaft wurde im Jahr 1982 zum Wort des Jahres gewählt. Zutreffend ist er oftmals auch heute noch - gerade während der pandemiebedingten Lockdowns, als Emotionen hochkochten, war er in den Supermärkten deutlich spürbar.
Sprachlich stammt das Wort von der Redewendung, seinen Ellbogen zu benutzen. Damit ist zum Beispiel gemeint, sich mithilfe des Ellbogens vorzudrängeln, zu raufen oder in sportlichen Wettbewerben die Konkurrenz zu behindern.
Eine Ellbogengesellschaft ist demzufolge geprägt von Konkurrenzdenken, Egoismus und Rücksichtlosigkeit. Es geht mehr um den eigenen Nutzen als um das Miteinander.

1971: aufmüpfig
Das erste Wort, dass es zum Wort des Jahres geschafft hat, ist aufmüpfig. Aufmüpfig heißt so viel wie "widersetzend" oder "aufsässig". Mit Ursprüngen in der Schweiz und nachdem es früher nur in Österreich und Bayern verwendet wurde, wird es seit den 1960er und 1970er Jahren im gesamten deutschsprachigen Raum genutzt und dir deshalb auch beim Deutsch Lernen schnell begegnen.
In diesen Jahren wurde es immer populärer und tauchte häufiger in der Presse auf. Die GfdS begründete die Wahl auch damit, dass der Begriff Teil der "Sprache der Linken" gewesen sei und so immer bekannter wurde.
Vollständige Übersicht der Wörter des Jahres seit 1971
Das erste Mal wurde im Jahr 1971 ein Wort des Jahres gewählt. Anschließend folgte eine mehrjährige Pause. Seit 1977 findet die Wahl jedoch kontinuierlich jedes Jahr statt. Eine vollständige Übersicht über alle seit 1971 gewählten Wörter des Jahres findest du hier:
| Jahr | Wort des Jahres |
|---|---|
| 1971 | aufmüpfig |
| 1977 | Szene |
| 1978 | konspirative Wohnung |
| 1979 | Holocaust |
| 1980 | Rasterfahndung |
| 1981 | Nulllösung |
| 1982 | Ellbogengesellschaft |
| 1983 | heißer Herbst |
| 1984 | Umweltauto |
| 1985 | Glykol |
| 1986 | Tschernobyl |
| 1987 | Aids, Kondom |
| 1988 | Gesundheitsreform |
| 1989 | Reisefreiheit |
| 1990 | Die neuen Bundesländer |
| 1991 | Besserwessi |
| 1992 | Politikverdrossenheit |
| 1993 | Sozialabbau |
| 1994 | Superwahljahr |
| 1995 | Multimedia |
| 1996 | Sparpaket |
| 1997 | Reformstau |
| 1998 | Rot-Grün |
| 1999 | Millennium |
| 2000 | Schwarzgeldaffäre |
| 2001 | der 11. September |
| 2002 | Teuro |
| 2003 | das alte Europa |
| 2004 | Hartz IV |
| 2005 | Bundeskanzlerin |
| 2006 | Fanmeile |
| 2007 | Klimakatastrophe |
| 2008 | Finanzkrise |
| 2009 | Abwrackprämie |
| 2010 | Wutbürger |
| 2011 | Stresstest |
| 2012 | Rettungsroutine |
| 2013 | GroKo |
| 2014 | Lichtgrenze |
| 2015 | Flüchtlinge |
| 2016 | postfaktisch |
| 2017 | Jamaika-Aus |
| 2018 | Heißzeit |
| 2019 | Respektrente |
| 2020 | Coronapandemie |
| 2021 | Wellenbrecher |
| 2022 | ? |
Je nachdem, wie alt du bist, wirst du wohl nicht mit allen Wörtern aus der Liste gleich etwas anfangen können. Das geht mir auch so. Es ist aber spannend, über unsere Beispiele oben hinaus einige der Wörter nachzuschlagen und mehr über den Hintergrund zu erfahren. So lernst du ziemlich sicher noch etwas über die letzten 50 Jahre der deutschen Geschichte dazu.
Hast du schon eine Idee, welches Wort wohl in diesem Jahr die Wahl gewinnen könnte? Wird es wieder auf die Corona-Pandemie anspielen, oder diesmal eher wieder auf eines der anderen vielen Themen, die unsere heutige Gesellschaft beschäftigen?
Jede Generation prägt Sprache auf ihre Weise. Ältere Menschen drücken sich anders aus als Jugendliche - und um die Sprache der jüngeren Generation mehr ins Licht zu rücken, lässt der Langenscheidt-Verlag jährlich das Jugendwort des Jahres wählen.
Mit KI zusammenfassen: