Wann war noch mal die letzte grosse deutsche Rechtschreibreform? Vor mittlerweile über 25 Jahren im Juli 1996! Weil sie aber diverse Male überarbeitet und vor allem ergänzt wurde (2004, 2006, 2011, 2017 und 2018) und zwischenzeitlich mehrere Stadien der Reform zuläßig waren, dauert sie gefühlt schon ewig - und seitdem schleppen wir die eine oder andere Unsicherheit mit uns rum. Radfahren oder Rad fahren? Auf deutsch oder auf Deutsch? Und wie war das schon wieder mit dem ß?
Die neue Rechtschreibreform
- Wurde am 1. Juli 1994 beschlossen
- Trat am 1. August 1996 in Kraft
- Löste zum Teil grosse Kritik aus
- Erhielt mehrere Revisionen und Ergänzungen
- ist seit 2018 gleichbleibend und wird inzwischen gut angenommen
Niemand – außer Profis, die täglich journalistisch schreiben vielleicht – ist sich in jedem Fall hundertprozentig sicher, wie man was schreibt oder ob man es sich zwischen verschiedenen erlaubten Schreibweisen aussuchen kann und wo man ein Komma setzt.
Bringen wir also Licht ins Dunkel und analysieren gemeinsam die wichtigsten Punkte.

Blick in die Vergangenheit: die Vereinheitlichung der deutschen Sprache
Im Mittelalter sprachen die Menschen in ihren heimischen Dialekten und schrieben wie sie sprachen – sofern sie schreiben konnten.
Erst der Handel des Spätmittelalters sorgte für eine einheitliche deutsche Sprache und von allem im neu geeinten Deutschen Reich mussten die Verordnungen des Kaisers verstanden werden. Das "Neuhochdeutsch" entstand als erste überregionale deutsche Sprache.
Aber selbst im 19. Jahrhundert gab es noch keine für den gesamten Sprachraum verbindliche Rechtschreibregelung. Das sollte sich ändern. Auf der „Orthographischen Konferenz“ in Berlin entstand 1901 erstmals eine für alle Länder verbindliche Rechtschreibregelung.
Als Grundlage für die erste Rechtschreibregelung diente die Schulnorm Preussens mit dem „Orthographischen Wörterbuch“ des Gymnasialdirektors Konrad Duden.
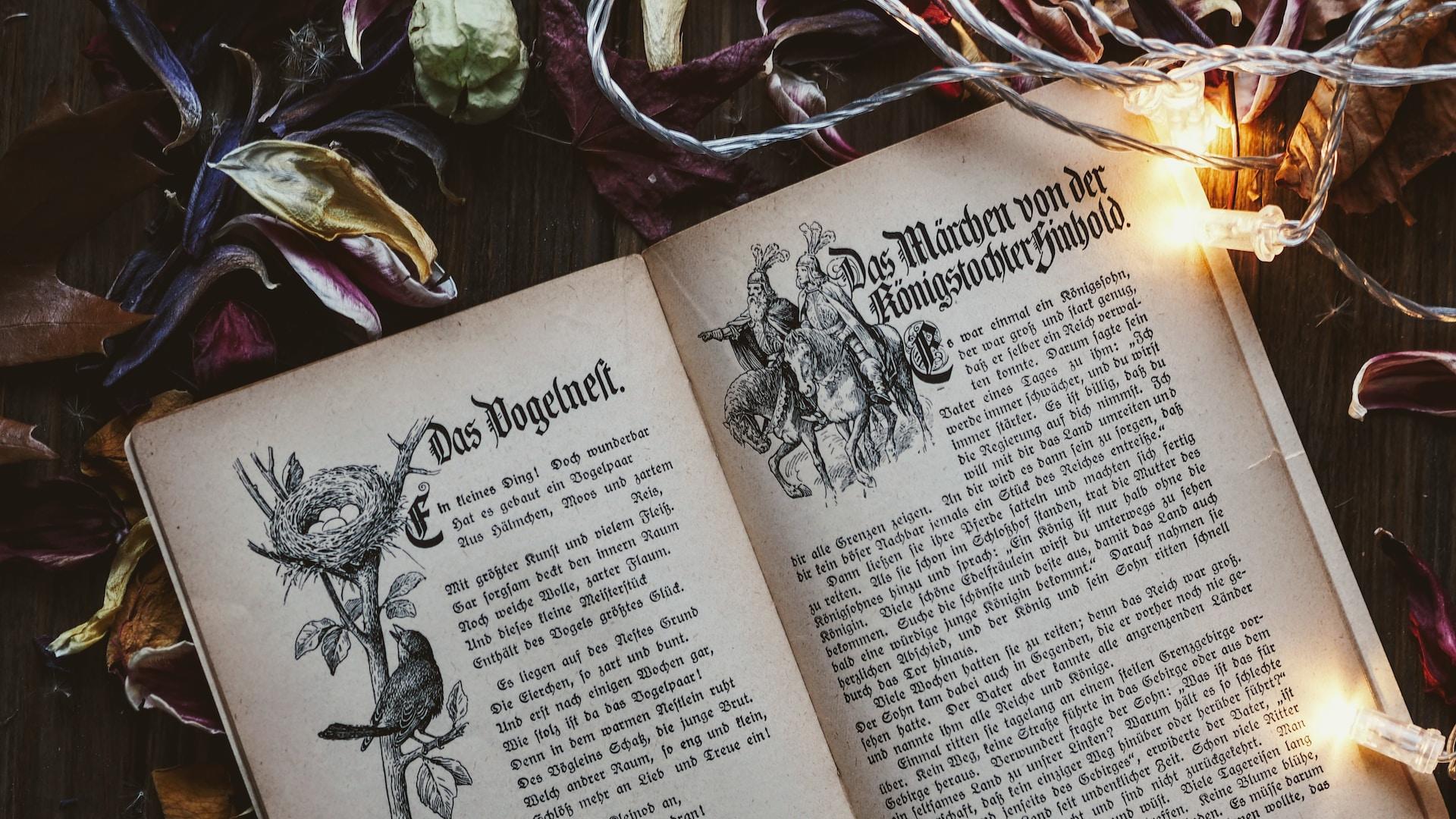
Ja genau: Er war der "Vater" des berühmten Wörterbuches "Der Duden". Zunächst wurden zahlreiche Varianten in der Schreibweise noch geduldet, dann aber immer weiter reduziert. Kompliziert war die deutsche Rechtschreibung auch damals schon. So schrieb man beispielsweise "In bezug auf", aber "mit Bezug auf" oder "Auto fahren", aber "radfahren". Kein Wunder, dass in Deutschland viele Mühe mit der Rechtschreibung haben.
Die Linguisten vom Institut für deutsche Sprache in Mannheim arbeiteten deshalb seit 1987 im Auftrag des Kultusministeriums an neuen, einfacheren Regeln. Am 1. Juli 1996 wurde die Neuregelung von den deutschen Kultusministern sowie Vertretern aller deutschsprachigen Länder (Schweiz, Liechtenstein und Österreich) unterzeichnet. Man versprach sich, bis zum 1. August 1998 die neue Regeln umzusetzen.
Stationen der Rechtschreibreform von 1996 bis 2018
Nachdem die Reform im Juli 1996 beschlossene Sache war, traten am 1. August 1998 die neuen Regeln in Kraft. Alle, die mit Wort und Schrift beschäftigt waren, hatte während zwei Jahren alle Hände voll zu tun. Viele Zeitungsredaktionen sahen sich gezwungen, ihre anfängliche Skepsis abzulegen und stellten ebenfalls auf die neuen Regeln um.
Die neue Rechtschreibung – ein Skandal!
Der eigentlich Sturm der Entrüstung gegen die Reform ging mit dem 1. August 1998 los. Es wurde geklagt, Unterschriften wurden gesammelt, 100 Schriftsteller und Wissenschaftler, darunter Günter Grass, Siegfried Lenz und Martin Walser forderten einen Stopp der Reform und der 2013 verstorbene deutsche Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki nannte die Rechtschreibreform gar eine "nationale Katastrophe".
- Ketschup
- Mayonäse
- Portmonee
- Schigore
Es führte kein Weg zurück. Die neue Schreibweise wurde in Schulen bereits angewendet und im Jahr 2001 erschienen 80 Prozent aller neuen Bücher in der neuen Rechtschreibung. Ab August 2006 wendeten sogar der Springer-Verlag und die FAZ die neuen Regeln an - bis dahin erbitterte Gegner der Neuerungen.
Eigentlich sollte mit der Reform vieles einfacher werden: Weniger Kommaregeln und mehr lautorientiertes Schreiben. Vor allem Kindern sollte es leichter gemacht werden, die korrekte Rechtschreibung zu erlernen.
Aber einige Regeln waren schwer nachvollziehbar: Eislaufen wurde ab sofort durch Eis laufen ersetzt und am Zeilenende durften einzelne Vokale im Zeilensprung abgetrennt werden: E - lefant, zum Beispiel. Beide dieser Regeln wurden 2006 wieder gekippt.
Die Bilanz nach 25 Jahren ist eher ernüchternd: Immer mehr Kinder haben Schwierigkeiten mit der deutschen Rechtschreibung. In der neunten Klasse scheitert ein Drittel am Deutsch.1
Die erste Reform der Reform
Bereits 1997 war angesichts der massiven Kritik die „Zwischenstaatliche Kommission für deutsche Rechtschreibung" gegründet worden. Sie sollte die Reform nachbessern.
Im Jahr 2006 wurde die Reform reformiert. Vor allem die Groß- und Klein- sowie Zusammen- und Getrenntschreibung wurden überarbeitet. Auch diese zweite Reform wurde stark kritisiert, da sie viele der Regelungen von 1998 nicht rückgängig machte, sondern um weitere Schreibweisen ergänzte oder wieder neu änderte.
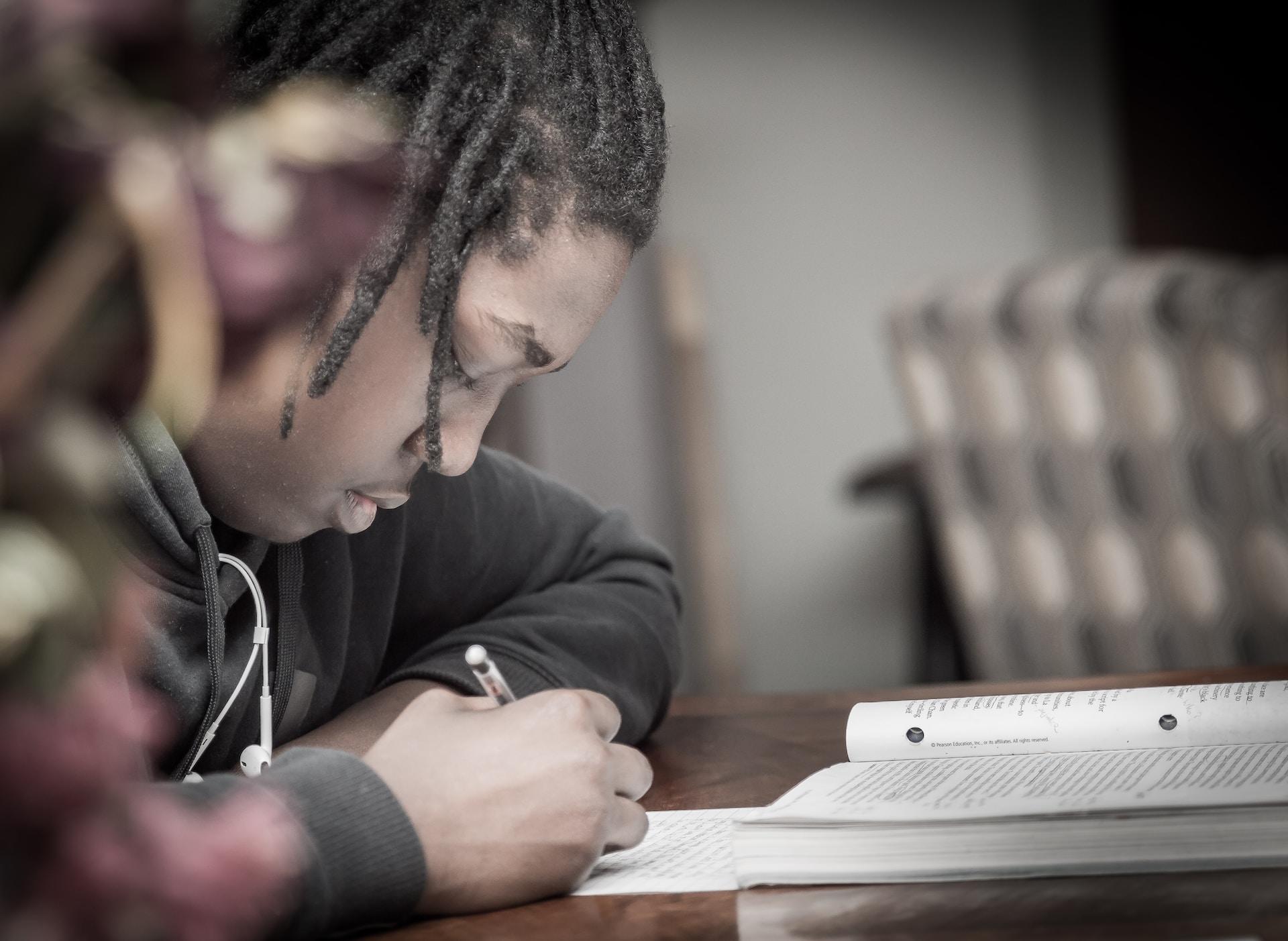
Bemühungen um eine Vereinfachung der Reform gehen weiter...
So richtig wollte in der Debatte um die Rechtschreibregeln keine Ruhe einkehren und fand einen neuen Tiefpunkt im Jahr 2004:
Im April beantragte die Sprachfachzeitschrift "Deutsche Sprachwelt" die Rückkehr zu den alten Regeln und trat damit eine erneute Diskussion los. Die "zwischenstaatliche Kommission" wurde vom "Rat für deutsche Rechtschreibreform" abgelöst und im Juli 2004 fand ein Treffen mit Delegierten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz in Wien statt. Im Herbst trat der "Rat für deutsche Rechtschreibreform" mit Neuerungen an die Öffentlichkeit. Sie beinhaltete vor allem neue Regelungen zu Groß- und Kleinschreibung, Zeichensetzung und Schreibweisen von Fremdwörtern. Diese Neuerungen wurde mehrheitlich ab dem 1. August 2005 angenommen.
... und wieder wird die Reform überarbeitet...
Im Jahr 2006 veröffentlichte der "Rat für deutsche Rechtschreibreform" erneute Änderungen, die vor allem die Fehler der ersten Reform ausbügeln sollte. So wurden einige Regeln wieder auf die alte Schreibweise zurück gesetzt. Zum Beispiel werden Wörter zusammen geschrieben, wenn sie einzeln einen anderen Sinn ergeben:
- schwerfallen
- fertigmachen
- freisprechen
- auseinandersetzen
Alle drei deutschsprachigen Länder stimmten dieser Reform zu.
... bis zu den vorerst letzten Änderungen 2017/18...
Die vorerst letzten Revisionen fanden 2011 und schließlich 2017/18 statt und betrafen nur noch wenige Worte oder Optionen. So zum Beispiel das Eszett als Grossbuchstabe.
Seit Juni 2017 gibt es ein großes Eszett:
Bisher musste bei der Schreibung eines Wortes in Großbuchstaben ein Eszett immer durch zwei s ersetzt werden. Dadurch veränderten sich Familien- oder Strassennamen. Denn liest man in Großbuchstaben FLOSSSTRASSE, wusste man bislang nicht, ob die Strasse nun die Floßstraße oder die Flossstraße ist. Das konnte mitunter für Verwirrung sorgen. Bei der Schreibung mit Großbuchstaben ist heute Doppel-s zuläßig, oder eben STRAẞE.
In der Schweiz gibt es kein ß.
Heute halten viele Linguisten die Annahme, man könne die deutsche Rechtschreibung wesentlich einfacher und logischer gestalten, für illusorisch. Die Reform habe nicht dafür gesorgt, dass die häufigsten Rechtschreibfehler im Deutschen vermieden werden. Der "Rat für die deutsche Rechtschreibreform" zieht ein positiveres Fazit: Die meisten Änderungen haben sich durchsetzen können und wurden angenommen. Der durch die Reform erwartete Kulturverfall ist ganz offensichtlich nicht eingetreten.
Die wichtigsten Rechtschreibregeln im Überblick
Damit du dir einen Überblick verschaffen kannst, haben wir dir hier die wichtigsten Regel der deutschen Rechtschreibreform zusammengetragen.
Wortverbindungen
Wortverbindungen werden vermehrt getrennt geschrieben. So zum Beispiel:
- spazieren gehen
- groß schreiben (im Sinne von "großer Anfangsbuchstabe")
Achtung: Großschreiben im Sinne von "hohe Achtung haben", schreibt man zusammen!
bei Ableitungen von -ig, -isch oder -lich trennt man immer, wie:
- müßig gehen
- heilig sprechen
- Französisch duschen
- liederlich leben

Möchtest du ein Rechtschreibe-Ass werden? Dieser Artikel zeigt dir, wie du deine Rechtschreibung verbessern kannst.
Substantivierte Adjektive und Partizipien
Substantivierte Adjektive oder Partizipien in Wortgruppen werden jetzt groß geschrieben:
- im Dunkeln tappen
- im Argen liegen
- Im Glück baden
Die Großschreibung von Adjektiven in bestimmten Fällen
Ein Adjektiv wird großgeschrieben bei:
Titeln, Ehren- und Amtsbezeichnungen
- der Regierende Bürgermeister
- die Königliche Hoheit
- der Heilige Vater
- der Erste Staatsanwalt
- die Leitende Ministerialrätin
offiziellen sowie kirchlichen Feier- und Gedenktagen
- der Erste Mai
- der Internationale Frauentag
- der Heilige Abend
Bei Funktionsbezeichnungen und besonderen Anlässe und Kalendertagen kann das Adjektiv großgeschrieben werden (muss aber nicht)
- die erste/Erste Vorsitzende
- die technische/Technische Direktorin
- die goldene/Goldene Hochzeit
- das neue/Neue Jahr
Auch wenn man es immer und überall in Großschreibung liest: "Herzlich willkommen!" ist und bleibt die einzig richtige Schreibweise! Alternativ wäre "Ein herzliches Willkommen!" auch korrekt.
Wie wäre es mit Deutsch Nachhilfe online?
Schreibeweise von Fremdwörtern und der Umgang mit f / ph
Viele der durch die Rechtschreibreform von 1996 eingedeutschten Fremdwörter haben sich nie durchsetzen können – siehe die paar Beispiele in der Info-Box. Deswegen hat der deutsche Rechtschreibrat viele wieder entfernt.
Handelt es sich nicht um einen Fachausdruck, werden heute Wörter mit F anstelle von PH geschrieben. Und der aus dem griechischen stammenden Wortteil -phon, phot, graph wird heute ebenfalls durch f ersetzt:
- Elefant
- Fotografie
- Telefon
- Fantasie
- Fotovoltaik
Doppel-s oder ß?
Während in der Schweiz auf ß verzichtet wird, solltest du in Deutschland und Österreich auf die korrekte Verwendung achten. Wenn du Probleme hast, dich zu entscheiden, spreche das Wort laut aus.

Bei kurzem Vokal wird das Wort mit Doppel-S geschrieben, wie hier Missbrauch. Aber auch
- Kuss
- Fluss
- bisschen
- dass (früher daß)
Bei langen Vokalen verwenden wir nach wie vor mit ß, zum Beispiel:
- Spaß
- Gruß
- Straße
- schließlich
Das selbe gilt bei vorangehenden Doppelvokalen (Diphthong):
- außerdem
- heißen
- außen
- fließen
- Grüße /grüßen
Vorsicht, Ausnahmen!
Ausnahmen bilden wenige Bezeichnungen, die einmal in einer Schreibweise festgelegt wurden. Zum Beispiel Litfaßsäule oder Schüßler-Salz. Ganz wenige Wörter werden in Österreich und Deutschland unterschiedlich ausgesprochen und deshalb auch anders geschrieben:
- Österreich: Geschoß / Deutschland: Geschoss
- Österreich: Spaß / Deutschland: Spaß oder Spass
Übrigens kann man das GROẞE "ẞ" über die Tastenkombination 1E9E Alt-C oder die Tastenkombination [Alt Gr] + [Shift] + ß erzeugen!
Drei gleiche Buchstaben bei Wortzusammensetzungen
Treffen bei zusammengesetzten Wörtern drei gleiche Buchstaben aufeinander, wird keiner davon gestrichen:
- Brennnessel
- Schifffahrt
- Stickstofffrei
Getrennt oder zusammen?
Wer die deutsche Rechtschreibung üben will, beschäftigt sich viel mit diesen Regeln.
Verben und Substantive am Anfang – Wort getrennt schreiben
Merke dir: wenn der erste Teil eines Wortes ein Verb ist, wird das Wort in der Regel getrennt geschrieben. Zum Beispiel "spazieren gehen".
Wörter mit einem Substantiv am Anfang – wie hier Rad – werden in der Regel ebenfalls getrennt geschrieben.
Nach der neuen Rechtschreibung schreiben wir: Rad fahren.

Einzelne Begriffe wie "pleitegehen" werden klein und zusammen geschrieben, da es sich um einen festgelegten Begriff handelt.
Mit einer Nachhilfe in Deutsch kannst du alle Regeln in Ruhe lernen und üben.
Wörter mit sein, werden und lassen
Zusammensetzungen mit dem Wort "sein" wie zum Beispiel "da sein" oder "dabei sein" werden getrennt geschrieben.
Bei Verbindungen von zwei Verben, die als zweiten Bestandteil die Verben "bleiben" oder "lassen" haben und im übertragenen Sinn gebraucht werden, wird das Wort zusammengeschrieben - zum Beispiel:
- an einer Barriere durchlassen
- in der Schule sitzenbleiben
Der Duden akzeptiert aber auch die getrennte Schreibweise "sitzen bleiben".
Groß oder klein?
In der neuen Rechtschreibung werden Tageszeiten nach Adverbien wie "gestern" oder "heute" groß geschrieben:
- heute Morgen
- gestern Mittag
- morgen Abend
Die Zeichensetzung
Mit der Reform sollten unter anderem die Kommaregeln vereinfacht werden. Für Kommata gibt es zahlreiche Kann-Bestimmungen.
Sätze mit und und oder
Bei Hauptsätzen, die mit und beziehungsweise oder verbunden sind, kann zur Gliederung des Satzes ein Komma gesetzt werden - muss aber nicht:
Jakob spielt mit Lego (,) und Ida malt ein Bild.
Anders ist es, wenn die Teilsätze mit entgegengestellten Konjunktionen aber, doch, jedoch, sondern verbunden sind. Hier brauchen wir ein Komma:
| Konjunktion | Satzbeispiel |
|---|---|
| aber | Sie tanzte, aber nur für sich allein. |
| doch | Wir probierten den Tee, doch er schmeckte bitter. |
| sondern | Sie brachten uns nicht nur zum Flughafen, sondern kamen auch in die Abflughalle. |
| jedoch | Jedoch freute er sich nur mäßig, dass wir auch dabei waren. |
Infinitivgruppen durch Komma trennen
Merke dir ebenfalls: Infinitivgruppen werden mit Komma getrennt, wenn als, anstatt, außer, ohne oder um auftauchen. Die Wörter müssen nicht in der Mitte des Satzes stehen.
| Wort nach Komma | ganzer Satz |
|---|---|
| als | er duckte sich, als der Wolf ihn entdeckte. |
| anstatt | Sie ging an den See, anstatt am Turnunterricht teilzunehmen. |
| außer | Jeden Montag ist Schule, außer es ist Feiertag. |
| um | Sie versteckte sich in der Bäckerei, um nicht gesehen zu werden. |
| ohne | Sie sagte den Termin ab, ohne einen neuen vorzuschlagen. |
Gleiches gilt, wenn Verben in Verbindung mit den Wörtern zu oder um stehen:
Wir hofften, den Zug pünktlich zu erreichen.
Um nicht aufzufallen, setzte er die Sonnenbrille auf.
Brauchst du Unterstützung in deutscher Grammatik, suchst du Nachhilfe Deutsch in Berlin?
Die deutsche Sprache hat schon viele Veränderungen erfahren, die sicher damals für viele schockierend waren, uns aber heute ganz normal erscheinen. Wer seine Kenntnisse in der deutschen Rechtschreibung weiter vertiefen möchte, kann zudem Nachhilfe Nürnberg privat in Anspruch nehmen.
Die gute Nachricht: Ganz große Änderungen seien laut Ludwig M. Eichener, Direktor des Instituts für Deutsche Sprache in Mannheim und Mitglied im Rat für deutsche Rechtschreibung, nicht mehr zu erwarten. Na dann!
Quellen
- Ratzsch, J. (2023): „In hohem Maße besorgniserregend“: Jeder dritte Neuntklässler scheitert an Deutsch-Mindeststandards. https://www.news4teachers.de/2023/10/in-hohem-masse-besorgniserregend-jeder-dritte-neuntklaessler-scheitert-an-deutsch-mindeststandards/
Mit KI zusammenfassen:
















Danke für diesen informativen Artikel.
Sapere Aude – Habe Mut, Dich deines Verstandes zu bedienen!
Welche Aussage, will ich mit diesem Satz treffen? – vs. – Welche Aussage will, ich mit diesem Satz treffen? Beim ersten Fragesatz, will ich den Schwerpunkt auf „Aussage“ legen. Beim zweiten Fragesatz, will ich den Schwerpunkt darauf legen, das ICH die Aussage getroffen habe. Ich kann aber auch schreiben: Welche Aussage will ich mit diesem Satz, treffen. Der Leser (i.S.v. Mensch) will mit dieser Aussage also einen Kern getroffen haben. Würde ich diesen Satz nun aber ohne eine Zeichensetzung (z.B. Kommasetzung) schreiben, überließe ich es der Leserschaft, wie sie diesen Satz (nach Lesart) definieren will. Fragt sich nur noch, ob man es richtig verstanden haben wird. (Hier habe ich mit man mit einem „n“ geschrieben) die Leserschaft [alle Personen] angesprochen. Hätte ich nun aber den Leser (i.S.v. den Mensch direkt) angesprochen haben wollen, ich hätte das „sie“ groß („Sie“) geschrieben. Wie, ich wollte konkret nicht den Mann, sondern eine Frau ange-sprochen haben? Auch dann hätte ich es als „Sie“, (die Leserin dieses Satzes, oder die Person dessen) geschrieben. Insgesamt, ist also der „Gesang“ der Aussage ausschlaggebend (Eigenschafts-wort) dafür, was ich gesagt haben will (Wie ich in den Wald hineinrufe, schallt es heraus!) Was damit gesagt worden sein sollte. Und die Schreibung mit dem „ß“? Wollte ich hier die Institution angesprochen haben, es wäre das Schloß (Gebäude) gemeint. Dieses Wort als Schloss (mit „ss“) geschrieben, und ich hätte das Schloss am Fahrrad gemeint, welches ich abgeschlossen hatte. Heute Geschlossen (!) heisst: Die Ladentür ist zugeschlossen. was folgeschließe ich darauß widerum insgesamt? Warum ich mir in Allem so sicher bin, obwohl ich damals den Schulabschluss auf der Sonderschule gemacht habe? Weil ich zugehört habe, als gesagt wurde […] bzw. anhand der Mimk und Gestik gemerk hatte, ob man mich mit der Aussage persönlich, oder nicht persönlich, angesprochen haben wollte, und nicht die Sache, oder die Anderen. Welchen Folgesatz darf man darauss wiederum schließen! Setze die Satzzeichen so, daß aus deiner Aussage dies hervor geht, was Du gesagt haben willst. Du lernst es aber wohl am Besten, wenn Du nicht jeden Schund, sondern die vernünftige Literatur ließt. Zusammengefasst: Nimm Dir also die Muße; eine „Eselsbrücke“, wozu man heute kaum noch Zeit hat, wo es z.B. heisst: “wer dähmlich mit „h“ schreibt, ist dämlich!“ Doch VORSICHT! Insbesondere bei uns Deutschen (Die Menschen)! Denn: Wer aber für alles offen ist, ist nicht ganz dicht! Und dann klappt „es“ (was auch immer) auch wieder mit der Nachbarin!
Nimm es abschliessend als einen „Trostpflaster“, wenn es (i.S.v. Verheißung) heißt: „Aus einem Genie, welches auf einem „Schrottplatz“ aufgewachsen ist, wird kein Einstein! Und warum nicht? Unsere Gesellschaft ist nunmal – politisch gewollt – in der Bildung leider nicht durchlässig! Wegen der Pandemie, blickt man außerdem sogar auf die Definition: Z73 im ICD-10-GM-2022 Codex!
hallo, Ich bin immer wieder verwundert, dass bei dem thema ““ss“ oder „ß“? als sogenannte “hilfe“ von langen und kurzen vokalen gesprochen wird. Im heutigen standard-hochdeutsch haben sich die längen derart angeglichen, dass der hinweis auf sie keine hilfestellung bedeutet. ‚Husten‘ und ‚mussten‘, ‚wesen‘ und ‚wessen‘, ‚abend‘ und ‚arbeit‘, etc. längenunterschiede? Wenn ja, dann nicht signifikant. Vielmehr handelt es sich um die unterschiedliche lautung zweier vokalvarianten: ‚husten‘ = “uhu-U“, ‚mussten‘ = “und-U“, etc. Es wäre begrüssenswert, wenn sich diese erkenntnis langsam durchsetzen würde.
Denn auch bei der entscheidung, ob ein doppelkonsonant geschrieben werden muss (‚offen‘ – ‚ofen‘) geht es nicht um die länge, sondern die unterschiedliche lautung des vorangehenden vokals.
Sehr informativ, vielen Dank. Außer dem Zahlendreher am Anfang („trat am 1. August 1969 in Kraft“…..
Vielen Dank für den Hinweis! Wir haben den Fehler korrigiert.